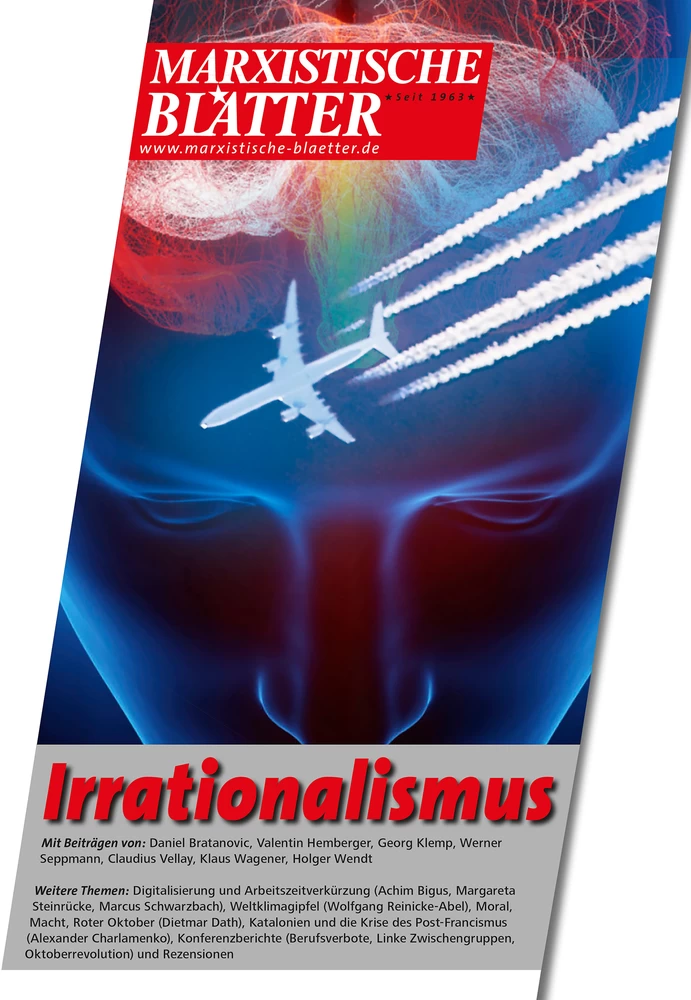Zusammenfassung
Weitere Themen: Digitalisierung und Arbeitszeitverkürzung (Achim Bigus, Margareta Steinrücke, Marcus Schwarzbach), Weltklimagipfel (Wolfgang Reinicke-Abel), Moral, Macht, Roter Oktober (Dietmar Dath), Katalonien und die Krise des Post-Francismus (Alexander Charlamenko), Konferenzberichte (Berufsverbote, Linke Zwischengruppen, Oktoberrevolution) und Rezensionen
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
»… wie man es im Marxismus-Leninismus-Unterricht gelernt hat.«
Lothar Geisler
2017 war ein gutes Jahr für Siemens. Der Umsatz kletterte auf 83 Milliarden Euro, der Nettogewinn auf 6,2 Mrd. Euro. Trotzdem ließ der Konzern seinen Wertschöpfern verkünden, 6.900 Arbeitsplätze zu streichen, davon 3.500 »bevorzugt« in Ostdeutschland. »Wenn es dem Unternehmen gut geht, geht es den Beschäftigten gut?« Pustekuchen!
Martin Schulz, Ex-Hoffnungsträger der SPD, hat das mit großer Pose »asozial« genannt und Siemens-Chef Joe Kaeser »Manchesterkapitalismus« vorgeworfen. Uiuiui! Auch Lothar de Maizière, CDU-Mann und letzter Ministerpräsident der DDR »geht mit dem Siemens-Konzern hart ins Gericht«. Eine Zwei-Mann-GroKo der besonderen Art. Während aber der Ex-Hoffnungsträger nur ein wenig links blinkt (um wieder rechts in die Zwei-Parteien-GroKo einzuschwenken), irritiert der Ex-Ministerpräsident mit später Einsicht. Da habe man 1990 so sehr »versucht, den ostdeutschen Menschen zu vermitteln, dass die soziale Marktwirtschaft etwas anderes ist als schnöder Kapitalismus« und jetzt »werden sie wieder einmal vom Gegenteil überzeugt.« Klartext: »Siemens geht es um schnöden Profit. Heute benehmen sich Unternehmer zunehmend so, wie man es im Marxismus-Leninismus-Unterricht gelernt hat.« (Neue Westfälische Bielefeld, 25.11.2017)
Da kann ich von Lothar (DKP) zu Lothar (CDU) nur zustimmen. Aber was heißt »heute«? »Wer nie bei Siemens-Schuckert war, bei AEG und Borsig, der kennt des Lebens Jammer nicht, der hat ihn erst noch vor sich.« Dieses Agitproplied war in den 1920er Jahren bei Arbeitern (m+w) höchst populär (nicht populistisch!). Nah dran am Alltag konnte man es damals so und ähnlich in der KPD-Zeitung »Rote Fahne« lesen oder in den frühen 1950ern im »Neuen Deutschland«. Und die westdeutsche Lehrlingsbewegung der 1960er/1970er Jahre rockte zu Liedern von Floh de Cologne. Motto: »Das Übel an der Wurzel packen, die Macht der Großkonzerne knacken.«
Wir alle wissen aus dem Alltag und der realen Geschichte (und zwar nicht erst seit heute, lieber Lothar de Maizière), zu welchen Verbrechen das Monopolkapital bereit ist und wir ahnen nur vage, zu welchen es im globalen (Markt-)Machtkampf zukünftig noch bereit sein wird, – für schnöden Profit. Selbst das vergessene Ahlener Programm der CDU zeigt, dass der gesellschaftliche Konsens über die notwendigen Lehren aus Krieg und Faschismus nach 1945 weit über zahnlos-zahme Appelle an die »Sozialpflichtigkeit des Eigentums« hinausging. In der DDR wurden diese Lehren gezogen, mit Macht, die auch den kapitalistischen Teilstaat BRD sozialer machte. Heute haben Siemens & Co bei »des Lebens Jammer« wieder ungebremst und überall ihre Finger bzw. Aktien drin, von Berlin bis Washington, auch wenn der Vergleich mit dem »Manchesterkapitalismus« hinkt!
»Gewisse Übel beklagen, ohne ihre abstellbaren Ursachen zu nennen«, solcherart Klage »entmutigt die unter den Übeln Leidenden und unterstützt jene, die die Leiden verursachen«, schreibt Bert Brecht in seinem Me-ti. Bestimmte Leiden kommen von bestimmten Besitz- und Machtverhältnissen. Und die sind keine Naturgewalten! Ein Bauer aus Peru, der wegen der Klimaschäden in seiner Heimat in der BRD gegen den Energieriesen RWE vor Gericht zieht, hat das begriffen. Er weiß, die Verursacher seines »Lebens Jammer« haben Name und Adresse. Ihrem weltweiten, gut vernetzten Treiben müssen wir gemeinsam ein Ende bereiten. Das ist der Kern der antimonopolistischen Strategie, die er so wenig kennt, wie den »Marxismus-Leninismus-Unterrichts«.
Das Scheitern der deutschen Klimapolitik
Wolfgang Reinicke-Abel
Der UN-Klimagipfel COP 23 in Bonn vom 6.–17.11.2017 markierte den Widerspruch: Zu Gast beim ressourcenhungrigen Braunkohle- und Exportweltmeister Deutschland, nur 50 Kilometer entfernt von der größten CO2-Quelle Europas, führt mit Fidschi ein Land den COP-Vorsitz, für das der Klimawandel bereits harte Realität ist.
Die Diskrepanz zwischen klimapolitischer Rhetorik und realer Emissionsentwicklung wächst: Langfristige Dekarbonisierungsziele und der Mythos vom grünen Deutschland stehen auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein exportgetriebenes Kapitalismusmodell, das durch eine spezifische Kräftekonstellation abgesichert wird, die eine rasche Reduktion der Treibhausgasemissionen nicht zulässt. Die imperiale Lebensweise, das heißt der Zugriff auf Ressourcen und Arbeitskräfte im Globalen Süden zur Sicherung des eigenen Lebensstandards, stützt das deutsche Kapitalismusmodell nach innen ab, indem nach wie vor breite Teile der Bevölkerung über relativ üppige Konsummöglichkeiten verfügen. Gleichwohl nimmt die Polarisierung der Einkommen auch in Deutschland zu und der Aufstieg rechtspopulistischer Strömungen deutet auf eine Hegemoniekrise hin. Zugleich bietet die Verbreiterung und Vertiefung der imperialen Lebensweise in Teilen des Globalen Südens dem exportorientierten deutschen Kapital neue Akkumulationsräume, beispielsweise über den Export von Autos, Fleisch oder grünen Technologien.
Deutschland ist Weltmeister in der Braunkohleverstromung, die Energiewende im Strombereich wurde stark gebremst, die soziale Schieflage in der Finanzierung nicht korrigiert, und die Arbeitsplätze im Bereich erneuerbarer Energien sind häufig prekär und schlecht bezahlt. In der Verkehrspolitik gehört Deutschland mit seiner einflussreichen Autoindustrie, die vorwiegend im sogenannten Premiumsegment produziert, zu den destruktivsten Ländern weltweit. Ob EU-Abgasrichtlinien, Dieselgate, Feinstaubbelastung oder fehlendes Tempolimit auf Autobahnen – eine Verkehrswende liegt in weiter Ferne. In der Agrarpolitik ist Deutschland ebenfalls weit davon entfernt, ein Vorreiterland zu sein. Die bäuerliche Landwirtschaft befindet sich seit Jahrzehnten in der Defensive. Die Stickstoffdüngung verharrt auf einem extrem hohen Niveau. Die ständige Steigerung der Fleischproduktion basiert auf immensen Futtermittelimporten. Bis zu einer Agrarwende ist es noch ein weiter Weg.
Zudem besteht die Kehrseite des deutschen Exportmodells in einem immensen Importbedarf bei Rohstoffen, insbesondere bei Metallen. Die Rohstoffpolitik wurde in den letzten Jahren unter dem Primat der Versorgungssicherheit aufgewertet. Der Zugriff auf Rohstoffe wird handelspolitisch abgesichert, die Interessen in den Herkunftsländern werden systematisch ausgeblendet. Sollte die ökologische Modernisierung – etwa durch die massive Ausweitung der Herstellung elektronischer Automobile – ausgeweitet werden, würde der Rohstoffbedarf auch unter grünen Vorzeichen weiter ansteigen. Eine absolute Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch ist schlicht nicht machbar. Das kapitalistische Wachstum in Deutschland basiert auf einer nicht verallgemeinerbaren imperialen Lebensweise. Deutschland ist kein grünes Vorzeigeland, sondern ein erheblicher Teil des globalen Klimaproblems.
Es soll nicht verschwiegen werden, dass es in den letzten Jahrzehnten durchaus wichtige Fortschritte gegeben hat. In erster Linie ist dabei die Energiewende im Strombereich zu nennen. Diese geht zurück auf die Umwelt- und Anti-AKW-Bewegungen und ihren jahrzehntelangen Kampf gegen die fossil-nukleare Energiewirtschaft. So konnte der Anteil regenerativer Energien in diesem Bereich auf etwa 35 Prozent erhöht und durch ihren dezentralen Ausbau die Vielfalt der Akteure vergrößert werden.
Darüber hinaus gibt es durchaus rudimentäre Ansätze für eine Verkehrswende. In den Städten geht der Autobesitz zurück und neue Modelle wie Car-Sharing werden erprobt. In die Fahrrad-infrastruktur wurde verstärkt investiert, die Veräußerung der Bahn konnte verhindert werden. Zahlreiche Initiativen setzen sich für einen beitragsfreien ÖPNV ein, und die Umweltverbände versuchen hartnäckig, die Verantwortlichen für den Abgasskandal zur Rechenschaft zu ziehen und erste Ansätze für eine Verkehrswende zu verallgemeinern. Im agrarpolitischen Bereich konnte, ähnlich wie im Stromsektor, eine Nische erkämpft werden. Ausgehend von der Umweltbewegung und mit neuem Schwung nach dem BSE-Skandal konnten Vertriebskanäle für bäuerlich und/oder biologisch erzeugte Produkte geschaffen und Verbraucherrechte gefestigt werden. Zudem zeichnet sich eine Änderung der Konsummuster hin zu einem geringeren Verzehr tierischer Nahrungsmittel ab. Innerhalb des Deutschen Bauernverbandes wachsen die Konflikte zwischen Kleinbauern und -bäuerinnen und der Verbandsspitze. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Konzepte für eine Agrarwende, die sowohl aus klima-politischer Perspektive als auch aus Verbraucherschutzgründen dringend geboten ist.
Rohstoffpolitisch zeichnet sich zumindest diskursiv ein Wandel ab. Soziale und ökologische Aspekte werden etwa in den Rohstoffpartnerschaften stärker berücksichtigt. Allerdings bleibt das Potenzial für eine andere Rohstoffpolitik gering, solange der Pfad des exportgetriebenen deutschen Kapitalismusmodells nicht verlassen wird, der auf eine ständige Vergrößerung des Ausstoßes ausgerichtet ist. Es ist bezeichnend, dass die Sektoren, in denen tatsächliche Emissionsreduktionen verzeichnet werden können, gar gesellschaftliche Veränderungen in Richtung von mehr Demokratie und mehr Nachhaltigkeit, diejenigen sind, in denen soziale Bewegungen als wirkmächtige Akteure auftreten. Das heißt, das Argument lautet nicht, dass Deutschland nicht in der Lage ist, der Öko-Vorreiter zu sein, der es gern wäre, sondern dass die wichtigen Schritte in diese Richtung zuerst von unten kommen müssen: von Bewegungen für eine genuine sozial-ökologische Veränderung.
Jamaika verhandelt, wir handeln
Natürlich wird die Rechtsentwicklung in der Bundesrepublik auch schwerwiegende Auswirkungen in den Bereichen der Ökologie haben. Die kommende Legislaturperiode wird davon gekennzeichnet sein, dass selbst die klimapolitischen Ziele und die Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien, die von der Bundesregierung bisher selbst verkündet worden sind, unter dem Druck der großen Energie-, Kohle- und Atomkonzerne weiter zurückgeschraubt werden
Dabei sind die schwerwiegenden Folgen der nicht eingehaltenen energiepolitischen Ziele in diesem Bereich unbestreitbar. Und zwar nicht nur in fernerer Zukunft, sondern schon in den unmittelbar nächsten Jahren. Und nicht nur in Afrika oder auf anderen Kontinenten, sondern auch hier bei uns mitten in Europa. Mit sich verschärfenden Extrem-Wettererscheinungen, Stürmen, Überschwemmungen, Trocken- und Dürreperioden, erheblicher Veränderung der Anbaubedingungen für Kulturpflanzen und landwirtschaftliche Produkte sowie schwerwiegenden Folgen für die ganze Biosphäre.
Umso stärker sollten wir also unsererseits an der Entwicklung breiter Bewegungen für die Durchsetzung der notwendigen Klimaschutzziele und die Umstellung auf erneuerbare Energien mitwirken. Angesichts der starken personellen und finanziellen Verflechtungen zwischen Politik und Industrie ist auf eine Einsicht bei den Verantwortlichen nicht zu setzen. Nur öffentlicher Druck wird sie bewegen. Dabei gibt es erste Erfolge: Beim Bürgerentscheid am Sonntag, den 5.11.2017 haben sich die MünchnerInnen mit einer Mehrheit von 60,2% für eine vorzeitige Stilllegung des Heizkraftwerks Nord 2 im Jahr 2022 ausgesprochen. Damit setzt München ein klares Signal für den Klimaschutz und den bundesweiten Kohleausstieg. 70 Umwelt-Organisationen und neun Parteien haben sich der Forderung nach der baldigen Abschaltung des Kohlekraftwerks angeschlossen und als starkes Bündnis gezeigt, dass die Gesellschaft bereit ist, klimapolitisch mehr Verantwortung zu übernehmen, als die Regierenden das bisher getan haben.
Der Klimagipfel COP23
Die gesteckten Ziele der 23. UN-Klimakonferenz wurden zwar erreicht, doch diese sind nur die Vorarbeiten für den nächsten Weltklimagipfel in einem Jahr. Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel. Am Montag, den 6.11.2017, hatte die 23. UN-Klimakonferenz (COP23) begonnen. Der Präsident der Konferenz und Premierminister der Fidschi-Inseln Frank Bainimarama wandte sich in einem dramatischen Appell an die Weltgemeinschaft: »Hilfe, wir gehen unter!« Zwar ist Fidschi sicherlich einer der Staaten, für die weitgehende Ergebnisse existenziell wären, aber die Bundesregierung wird sich kaum als Antreiber zu ehrgeizigen Zielen betätigen. Deutschland wird die selbstgesetzten Klimaziele deutlich verfehlen und es ist nicht sichtbar, dass dies der Bundesregierung Kopfzerbrechen bereiten würde.
Bereits am vorausgegangen Samstag hatten 25.000 Menschen in der Bonner Innenstadt einen schnellen Kohleausstieg unter dem Motto »System change, not climate change« gefordert. Darunter waren über 1.000 Fahrradfahrer, die von Köln aus über die »abgeholzte« Bonner Straße und dann über die A 555 nach Bonn fahren wollten, von der Polizei aber unsanft auf die Landstraße umgeleitet wurden. Am Sonntag gingen bei einer Aktion Zivilen Ungehorsams 4.500 Menschen in den Tagebau im benachbarten Rheinischen Braunkohlerevier und blockierten vorübergehend zwei Großbagger. Die Organisatoren erklärten: »Gemeinsam haben wir heute ein wichtiges Zeichen für konsequenten Klimaschutz und den Ausstieg aus der Kohleverstromung gesetzt. Von der Bundesregierung erwarten wir, dass sie das Pariser Klimaschutzabkommen endlich wirkungsvoll umsetzt. Die dreckigste Hälfte der Kohlekraftwerke muss in wenigen Jahren abgeschaltet sein, denn Klimaschutz entscheidet sich am Kohleausstieg.«
Mehr als 100 Klima- und Umweltschutz-, Bürgerrechts- sowie kirchliche Organisationen und Entwicklungsverbände aus Deutschland und der ganzen Welt hatten zur Demonstration aufgerufen. Darunter auch die DKP. Parallel zur COP23 läuft in Bonn die weltweite Versammlung der klimapolitischen Bewegungen »People’s Climate Summit« (PCS). Am Samstag, den 11. November, startete um 11:11 Uhr die Demonstration »Schluss mit dem faulen Zauber – wir treiben die bösen Geister des Klimawandels aus: Kohle, Erdöl, Atom!«. Über 4.000 Teilnehmer kamen trotz widriger Witterung und der beginnenden Karnevalssession im Rheinland.
»Zwei Drittel des Erdöls, die Hälfte des Erdgases und 80 Prozent der Kohle müssen in der Erde bleiben«, sagte Dagmar Paternoga von Attac Deutschland. »Der Energieverbrauch für Produktion und Transport, der Auto- und Flugverkehr sowie die industrielle Fleischproduktion müssen sofort und drastisch reduziert werden. In einer profitgetriebenen Ökonomie wird das nicht möglich sein. Kapitalismus und Wachstumszwang, […] müssen infrage gestellt werden.«
Das Klimaschutz-Ziel lautet: minus 40 Prozent CO2-Ausstoß bis 2020. Dieses Ziel duldet keine Kompromisse. Derzeit fehlen allein in der Bundesrepublik 12 Prozentpunkte. Diese innerhalb von drei Jahren einzusparen, kann funktionieren – aber nur mit einem sehr beherzten Kohleausstieg. Gebäude sanieren, Heizungen austauschen, beim Verkehr einsparen, Moore schützen. Aber bis Häuslebauer ihre Gebäude sanieren, bis Menschen auf andere Verkehrsmittel umsteigen und Moore wieder CO2 speichern, verrinnt wertvolle Zeit. Nur bei der Kohle lässt sich bis 2020 genug erreichen.
20 Gigawatt Kohlekraft müssten bis 2020 vom Netz, um das Klimaziel zu erreichen. Bei den Jamaika-Verhandlungen bot Angela Merkel 7 Gigawatt an. Fast alle unsere Nachbarn sowie etliche weitere Staaten haben sich auf der Weltklimakonferenz zu einer mutigen Koalition gegen die Kohle zusammengeschlossen. Die Bundesrepublik Deutschland fehlt. Das ist ein katastrophales Signal. Die Folgen des Klimawandels bringen schon jetzt Elend und Tod, besonders den Ärmsten auf unserem Planeten. Und er kann das größte Artensterben seit dem Aussterben der Dinosaurier auslösen.
Ziele der diesjährigen UN-Klimakonferenz
Im Fokus waren auf dieser Weltklimakonferenz in Bonn vor allem die Vorarbeiten für ein »Regelbuch«. Dieses »Rule Book« soll die Klimaschutz-Zusagen der einzelnen Staaten überprüfbar und miteinander vergleichbar machen. Es gehe ums »Kleingedruckte« im »Grundgesetz des Klimaschutzes«, erläuterte Karsten Sach, Leiter der Abteilung Klimaschutzpolitik im Bundesumweltministerium, vorab.
Die Positionen aller beteiligten Staaten wurden dafür in Bonn zusammengetragen, auf Hunderten von Seiten. Damit habe die UN-Klimakonferenz ihren Auftrag erfüllt, erläuterte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks im Anschluss. Mehr war für COP23 nicht geplant. Auf dem nächsten Klimagipfel Ende 2018 in Kattowitz in Polen müssen diese einzelnen Verhandlungstexte dann zu einem zusammengeführt werden, der von den Staaten der Klimakonferenz verabschiedet werden kann, was vermutlich der strittigere Teil sein wird.
So weit hat die diesjährige Klimakonferenz also ihre gesteckten Ziele erreicht. Doch offenbar nicht mit Schwung, sondern eher im Schleichschritt: Ein Teilnehmer der Konferenz urteilte, es sei noch nie so wenig Adrenalin im Spiel gewesen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sprach von »Trippelschritten beim Klimaschutz« und auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace vermisste »Mut und Enthusiasmus« auf dem Weltklimagipfel: »Der oft beschworene Pariser Geist blitzt in Bonn kaum auf.«[1]
Regelmäßige Nachbesserung als Regelwerk
Den Pariser Geist wird die UN-Klimakonferenz aber auch in den folgenden Jahren noch oft brauchen, denn man will nicht bei den ehrgeizigen Plänen, die 2015 in Paris verabschiedet wurden, stehen bleiben. Denn bereits jetzt ist klar: So ließe sich das Zwei-Grad-Ziel nicht mehr halten. Damit die Klimaerwärmung nicht höher ausfällt, müssen alle Staaten der UN-Klimakonferenz nachbessern, und das regelmäßig: Alle fünf Jahre sollen die Nationen ihre eigenen Klimaschutzziele verschärfen. Ab 2018 starten die Nachbesserungsrunden im Testlauf, ab 2023 dann regelmäßig alle fünf Jahre. Auch die Bundesregierung ist hier mit ihren eigenen Zielen gefragt.
Doch Deutschland, das sich lange als Musterschüler im Klimaschutz gefiel, enttäuschte auf der UN-Klimakonferenz. Angesichts der gleichzeitig noch stattfindenden (mittlerweile gescheiterten) Sondierungsgespräche einer möglichen nächsten Regierungskoalition aus CDU, CSU, FDP und den Grünen äußerte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in Bonn in Bezug auf den Ausstieg aus der Kohle nur vage: »Wir in Deutschland werden uns mühen.«
Deutschland übernahm »nur« die technischen Aufgaben des Gastgebers, den Vorsitz der Konferenz hatte jedoch die Republik Fidschi. Da es auf dem Gebiet des Inselstaats im Pazifik aber keinen Versammlungsort für die bis zu 25.000 Teilnehmer gibt, tagte der Klimagipfel in Bonn, wo auch das Klimasekretariat der Vereinten Nationen seinen Sitz hat. Dort findet der Gipfel immer dann statt, wenn sich kein Gastgeber auf dem Kontinent findet, der turnusgemäß mit der Ausrichtung an der Reihe wäre.
Mit oder ohne die USA?
Im Juni des vergangenen Jahres verkündete US-Präsident Donald Trump, die USA werden aus dem Klimaabkommen von Paris aussteigen. Das Abkommen benachteilige die Vereinigten Staaten von Amerika. Doch der Austritt ist erst in drei Jahren möglich, am 4. November 2020. Daher saßen in Bonn auf der Klimakonferenz auch Vertreter der US-Regierung am Verhandlungstisch. Eine gefürchtete Blockadehaltung gab es offenbar nicht: Die US-Delegation habe sich neutral und konstruktiv verhalten, meinte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks am Ende der Klimakonferenz.
Auch aus dem eigenen Land wehte der US-Regierung in Bonn Gegenwind entgegen: Einzelne US-Staaten wie Kalifornien haben zusammen mit verschiedenen Kommunen und Unternehmen das Bündnis »We are still in« (»Wir sind immer noch dabei«) geschlossen, das auf eigene Faust die ursprünglich gesteckten Klimaziele erreichen will. Dieses Bündnis war ebenfalls auf dem UN-Klimagipfel vertreten. Und so schlossen sich auch mehrere US-Bundesstaaten der gegen Ende der Klimakonferenz eingegangenen Allianz von 18 Staaten für den Ausstieg aus der Kohle an.
Erderwärmung schreitet voran
Die Teilnehmer der UN-Klimakonferenz sind sich einig, dass die Erderwärmung gestoppt oder zumindest gebremst werden muss. Doch anstatt den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, blasen insbesondere die westlichen kapitalistischen Industrienationen immer mehr davon in die Erdatmosphäre. Im Jahr 2016 war die Konzentration an CO2 so hoch wie noch nie, warnte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO).
Nach Einschätzung des Weltklimarats (IPCC) wird die Temperatur Ende des Jahrhunderts vier Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau liegen, falls keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Der fünfte Weltklimabericht des IPCC zeigt das deutlich.
Im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter ist die weltweite Durchschnittstemperatur bereits deutlich gestiegen. Der größte Teil der Treibhausgase wird weiterhin von den Industrieländern ausgestoßen. Die Pro-Kopf-Emission wird dort noch auf Jahre die der Entwicklungsländer deutlich übersteigen. Die Industrieländer haben daher eine historische wie aktuelle Verantwortung im Kampf gegen den Klimawandel – so sieht es jedenfalls die EU. Doch es ist auch klar, dass die Entwicklungsländer den Industriestaaten auf dem Weg des Fortschritts folgen wollen und somit mehr Treibhausgase ausstoßen werden.
Besonders in Schwellenländern wie China und Indien werden die Emissionen in den nächsten Jahren stark zunehmen, wenn es nicht gelingt, das erwünschte wirtschaftliche Wachstum von der Zunahme der Treibhausgase zu entkoppeln. Doch viele Entwicklungsländer fürchten: Strenge globale Regeln für den Klimaschutz könnten ihr Wirtschaftswachstum bremsen. Umso dringender war es, mit dem Abkommen von Paris ein neues globales Klimaabkommen zu finden, dem sich auch Schwellen- und Entwicklungsländer anschließen können.
[1] Sweelin Heuss, Greenpeace-Geschäftsführerin
Wir warnen vor einem neuen Krieg im Mittleren Osten
attac-Beirat
Stellungnahme von 31 Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats von attac Deutschland zu Trumps Umgang mit dem Iran-Atomabkommen
Donald Trump, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, hat schon während seines Wahlkampfes das »Iran-Atomabkommen« als »das schlechteste Abkommen« angeprangert, »das die USA je abgeschlossen haben«. Mit der Bekanntgabe seiner Iran-Strategie am 13. Oktober hat er das Abkommen massiv in Frage gestellt. Ein für Iran entscheidendes Element dieses Atomabkommens ist die Aussetzung der Wirtschaftssanktionen. Dazu verpflichtete der US-Kongress den Präsidenten, periodisch zu bestätigen, dass der Iran gegen das Abkommen nicht verstoßen hat.
Obwohl die internationale Atomenergiebehörde keine Verstöße des Irans gegen das Abkommen festgestellt hat, weigerte sich Trump, die Einhaltung des Abkommens durch den Iran zu bestätigen. Innerhalb von 60 Tagen muss nun der US-Kongress entscheiden, ob die USA die schon vor dem Atomabkommen verfügten harten Wirtschaftssanktionen gegen den Iran erneut in Gang setzt. Diese Sanktionen sind hauptsächlich zu Lasten der Bevölkerung gegangen und haben das tägliche Leben stark belastet. Trumps Strategie ist durchsichtig: Er verfolgt das Ziel, Iran zur Aufkündigung des Abkommens zu provozieren. Damit wäre der gefährliche Nuklearkonflikt, der schon 2006 unter Bush Junior beinahe zu einem Krieg des Westens gegen den Iran geführt hätte, in vollem Umfang wieder auf der Weltbühne, und der Iran wäre dann der Schuldige.
George W. Bush benutzte damals das iranische Atomprogramm als Vorwand, um einen Regime-Change im Iran herbeizuführen, notfalls auch gewaltsam. Nun nimmt Trump das Abkommen mit Iran zum Anlass, um den Iran als Regionalmacht auszuschalten, notfalls durch einen neuen Krieg im Mittleren Osten. Die massive Aufrüstung Saudi Arabiens mit Waffenexporten im Umfang von 350 Milliarden US-Dollar und die neuerlichen Reisen des saudischen Königs zunächst nach Moskau, dann zusammen mit dem US-Außenminister Tillerson nach Baghdad müssen vom Iran als politische und militärische Umzingelung und Schritte zur Kriegsvorbereitung wahrgenommen werden. Die jüngsten Beschuldigungen des saudischen Kronprinzen und des überraschend zurückgetretenen libanesischen Präsidenten Hariri, der Iran und die Hisbollah destabilisierten den Libanon, dienen offensichtlich nur dazu, die Konfrontation mit dem Iran zu verschärfen. Sie haben unsere Befürchtungen bestätigt, dass insbesondere Saudi-Arabien seine Kriegsvorbereitungen gegen den Iran verstärkt.
Wir verurteilen auf das Schärfste den neuen Versuch der USA und seines engen Verbündeten Saudi Arabien, nach dem Kriegsdesaster im Irak einen neuen und noch größeren Flächenbrand im Mittleren Osten zündeln zu wollen. Die EU und die deutsche Bundesregierung, die zusammen mit Obama starken Anteil am Zustandekommen des Iran-Atomabkommens hatten, widersprachen umgehend und unmissverständlich der Absicht des US-Präsidenten, das Atomabkommen mit Iran in Frage zu stellen. Wir begrüßen diese klare Haltung der EU und fordern sie auf, nicht zurückzuweichen. Gleichwohl kann die gegenwärtige Haltung der Bundesregierung und der EU nicht vergessen machen, dass sie in der Vergangenheit die Strategie der US-Regierung unter George W. Bush im Iran-Atomkonflikt, vor allem sämtliche Sanktionsbeschlüsse, die die USA initiiert haben, aktiv mitgetragen und teilweise sogar verstärkt haben. Wir haben auch nicht vergessen, mit welcher Intensität die Regierungen der meisten Nato-Staaten, einschließlich der EU und ihrer »Leitmedien«, das Feindbild Iran aufbauten und eine regelrechte psychologische Kriegsvorbereitung betrieben. Erst als Barack Obama die Konfliktstrategie gegenüber dem Iran stoppte, ist auch die EU auf Obamas Politik der Konfliktentschärfung eingeschwenkt und hat mit der US-Regierung konstruktiv an der Beilegung des Iran-Atomkonflikts mitgewirkt.
Ein wichtiges Element des Sanktionsregimes von USA und EU sind exterritoriale Sekundärsanktionen, die der iranischen Wirtschaft und der Bevölkerung vor dem Atomabkommen erheblichen Schaden zugefügt haben. Solcherart Sanktionen richteten sich nicht nur gegen den Iran, sie richteten sich gegen alle EU-Firmen, die mit dem Iran wirtschaftliche Beziehungen unterhielten. Die erneuten Sanktionen gegen den Iran, die Trump und viele Republikaner nachhaltig verfolgen, ist ein ernst zu nehmender Versuch, die EU-Geldinstitutionen und -Firmen durch die zu erwartenden hohen Strafen dazu zu zwingen, ihre Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran zu beenden und die EU wieder auf US-Kurs zurückzubringen. Wir erinnern die EU an ihre eigene Verordnung 2271 aus dem Jahr 1996, die Sanktionen, die extraterritorial wirken, für völkerrechtswidrig erklärt. Sie war die Reaktion auf die Versuche der USA, Sanktionen gegen Kuba und Iran mit Wirkung gegen andere Länder durchzusetzen (sog. Helms-Burton-Act). Die Außenwirtschaftsverordnung in Deutschland verbietet ausdrücklich deutschen Firmen, sich an dem Boykott zu beteiligen, der nicht durch Deutschland, die EU oder die UNO beschlossen wurde (§7).
Die EU müsste eine aus den eigenen langfristigen Interessen abgeleitete und an einer friedlichen Kooperation mit allen Staaten des Nahen und Mittleren Ostens angelehnte Politik entwickeln und sie auch offensiv durchsetzen. Die EU hat die historische Chance, ihre Iran- und Mittelostpolitik auf neue und von den Vereinigten Staaten unabhängige Gleise zu stellen. Donald Trump hat in seiner rücksichtslosen Art offen gelegt, welchen politischen und ökonomischen Preis Europa für seine blinde Gefolgschaft zu den USA zu zahlen hat. Wir Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dieser Stellungnahme verurteilen die gefährliche Konfliktstrategie der USA im Mittleren Osten und fordern die deutsche Bundesregierung und die EU auf, sich klar davon zu distanzieren. Darüber hinaus fordern wir EU und Bundesregierung auf:
- Schon jetzt an die Adresse von USA, Saudi Arabien und Israel öffentlich zu – erklären, dass sie einen Krieg gegen Iran ablehnen und sich nicht an ihm beteiligen werden;
- Den Internationalen Gerichtshof in Den Haag zur völkerrechtlichen Überprüfung der extraterritorialen Sekundärsanktionen anzurufen;
- Schon jetzt der US-Regierung unmissverständlich zu signalisieren, dass sie im Falle von US-Sanktionen gegen Iran alle ihrer Möglichkeiten nutzen werden, um den Handel mit Iran sicherzustellen. Auch ausländische Investitionen im Iran sollten seitens der EU so abgesichert werden, dass die begonnenen und zukünftigen Investitionen im Iran auch weiterhin möglich sein werden;
- Das Iran-Atomabkommen zum Anlass zu nehmen, eine Konferenz für eine Massenvernichtungswaffen-freie Zone im Mittleren und Nahen Osten mit dem Ziel einzuberufen, alle nuklearen, chemischen und bakteriologischen Waffen abzuschaffen. Die Iranische Regierung hat zu einer solchen Konferenz bereits ihre Zustimmung signalisiert.
Berlin, den 20.11.2017
UnterzeichnerInnen
Prof. Dr. Elmar Altvater, Dr. Axel Bust-Bartels, Prof. Dr. Rudolph Bauer, Dr. Josef Berghold, Prof. Dr. Armin Bernhard, Prof. Dr. Ulrich Duchrow, Prof. Dr. Dr. h.c. Frigga Haug, Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Fritz Haug, Prof. Dr. Heide Gerstenberger, Prof. Dr. habil. Peter Herrmann, Prof. Dr. Rudolf Hickel, Dr. Heike Knops, Dr. Lydia Krueger, Prof. Dr. Birgit Mahnkopf, Prof. Dr. Mohssen Massarrat, Prof. Dr. Klaus Meschkat, Dr. Lutz Mez, Dr. phil. Dipl-Ing. Wolfgang Neef, Prof. Dr. John P. Neelsen, Prof. Dr. Norman Paech, Prof. Dr. Niko Paech, Dr. Urs Müller-Plantenberg, Dr. Werner Rügemer, Dr. Thomas Sablowski, Prof. Dr. Michael Schneider, Prof. Dr. Gerd Steffens, Dr. Fritz Storim, Prof. Dr. Isidor Wallimann, Dr. Christa Wichterich, Prof. Dr. Frieder Otto Wolf, Dr. Winfried Wolf
Metall-Tarifbewegung 2018: »neue Aktualität« für »Kurze Vollzeit«?
Achim Bigus
Vor dreißig Jahren, während der Auseinandersetzung 1987 um den zweiten Schritt hin zur 35-Stunden-Woche, erschien im VSA-Verlag unter dem Titel »Wem gehört die Zeit« ein »LESEBUCH zum 6-Stunden-Tag«. Als »Gliederungsprinzip dieses Lesebuchs« hatte eine der beiden Herausgeberinnen, Ingrid Kurz-Scherf, einen »Phantastischen Tarifvertrag« entworfen als »konkrete Utopie in 13 Paragraphen, verfasst in der Sprache der Tarifexperten« (S. 10). In diesem heißt es, er verbinde »die bewährte Tradition des im Prinzip für alle abhängig Beschäftigten gleichen Normalarbeitstages (…) mit dem Gedanken der überdurchschnittlichen Anrechnung von Arbeitszeiten unter unvermeidbaren, besonderen Belastungen (…) und mit dem Erfordernis, außerbetrieblichen Belastungen durch gesellschaftlich notwendige Arbeit in der Gestaltung der Erwerbsarbeit Rechnung zu tragen« (S. 12).
Ein Teil dieser Überlegungen steckt auch in den Forderungen der IG Metall für die Tarifauseinandersetzung 2018 in der Metall- und Elektroindustrie. Erstmals seit 15 Jahren haben die regionalen Tarifkommissionen der IG Metall neben der Forderung nach 6% mehr Entgelt auch Forderungen zu den Arbeitszeitregelungen in den Manteltarifverträgen aufgestellt:
Alle IG Metall-Mitglieder sollen einen Rechtsanspruch bekommen auf eine »Wahloption« für »kurze Vollzeit«: Verkürzung der individuellen regelmäßigen Wochen-Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden für bis zu zwei Jahre, wobei die abgesenkten Stunden zu Freischichten oder längeren Freizeitblöcken gebündelt (»verblockt«) werden können;
Wie bei Teilzeit bezahlen diese »kurze Vollzeit« zunächst die Arbeitenden selbst durch entsprechenden Lohnverlust – aber anders als im Teilzeit- und Befristungsgesetz soll es ein Rückkehrrecht auf Vollzeit geben;
Für alle, die diese »kurze Vollzeit« in Anspruch nehmen zur Betreuung von Kindern, zur Pflege von Angehörigen oder zur Entlastung bei besonders belastenden Arbeitszeiten wie Schichtarbeit soll es zudem einen Teil-Entgeltausgleich geben – nicht einkommensabhängig, sondern als Festbetrag- um besonders die unteren Entgeltgruppen vor zu hohen Lohnverlusten durch die kürzere Arbeitszeit zu schützen.
Lebensphasenorientierte Arbeitszeitverkürzung
Bei diesen Forderungen nach »Arbeitszeiten, die zum Leben passen« können sich die Tarifkommissionen und der Vorstand der IG Metall auf Ergebnisse der bundesweiten Beschäftigtenbefragung ihrer Organisation in diesem Frühjahr berufen. Daran hatten über 680.000 Arbeitende aus allen von der IG Metall vertretenen Branchen teilgenommen, darunter 38,1 Prozent Nichtmitglieder. Einige Ergebnisse:
- Für 47,7 Prozent ist die 35-Stunden-Woche die »Wunscharbeitszeit«;
- Der Aussage »Es wäre gut, vorübergehend die Arbeit absenken zu können« stimmen 82,3% zu oder eher zu;
- 57,1% erklärten, sie würden gerne weniger arbeiten, könnten sich dies finanziell aber nicht leisten;
- 29% der Teilzeitbeschäftigten (zu 81,1% Frauen) würden gerne ihre Arbeitszeit aufstocken, aber ihr Unternehmer lehnt dies ab;
- 90,1% aller Befragten fänden für Teilzeitbeschäftigte ein gesetzliches Rückkehrrecht auf Vollzeit wichtig oder eher wichtig;
- Arbeitende in Schichtarbeit (im Westen 30,2%, im Osten 56,1%) waren deutlich weniger zufrieden mit ihrer Arbeitszeit als solche ohne Schichtarbeit.
»Wahloption« – Einstieg in oder Ersatz für »Kurze Vollzeit« für alle?
Anders als die Herausgeberinnen und AutorInnen des »Lesebuches zum 6-Stunden-Tag« von 1987 verbindet allerdings zumindest der Vorsitzende der IG Metall diese Forderungen nicht mit der Perspektive einer weiteren Arbeitszeitverkürzung für alle: »Es geht schon lange nicht mehr um die weitere kollektive wöchentliche Arbeitszeitverkürzung. Stattdessen wollen wir den unterschiedlichen Lebenslagen der Menschen gerecht werden: Eltern haben andere Arbeitszeitansprüche als junge Leute, die gerade ausgelernt haben oder von der Hochschule kommen, oder Menschen, die Angehörige pflegen. Ältere wollen flexible Übergänge in die Rente. Mehr Selbstbestimmung und Flexibilität für die Beschäftigten sind unser Ziel.«[1]
Gesamtmetall: Rollback auf ganzer Linie
Trotz dieser eher bescheidenen IG Metall-Position erklärt Gesamtmetall, die IG Metall habe mit der Kündigung der Manteltarifverträge die »Büchse der Pandora« geöffnet. Die Forderung nach Teil-Entgeltausgleich für Kindererziehung oder Pflege kommentiert Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger: »Mehr Geld für’s Nichtstun wird es mit uns nicht geben.«[2]
Schon in die erste Verhandlungsrunde starteten die Unternehmerverbände mit massiven Gegenforderungen, was eher ungewöhnlich ist. Vor allem wollen sie die Möglichkeit, in Einzelarbeitsverträgen längere Arbeitszeiten zu vereinbaren – heute begrenzt auf 18% der Belegschaft – auf alle Beschäftigten ausweiten, also faktisch nicht weniger als die Aufhebung der kollektivvertraglichen 35-Stunden-Woche durch die einzelvertragliche Hintertür!
»Für Zeiten, in denen ein situationsbedingter Bedarf nach einem erhöhten Arbeitszeitvolumen besteht«, fordern sie »vorübergehende Erhöhung der Arbeitszeit bei entsprechendem zuschlagsfreien Entgeltausgleich«. Nicht nur die Überstundenzuschläge sollen somit wegfallen, sondern auch Zuschläge für Schicht- und Nachtarbeit, »wenn der Beschäftigte selbst die Lage der Arbeitszeit bestimmen kann« – dies begründen sie u.a. mit »Zeiten des weltweit abgestimmten Arbeitens«, was eher weniger mit »Selbstbestimmung« der Arbeitenden zu tun hat.
Die Dauer sachgrundloser Befristungen wollen sie per Tarifvertrag erweitern. Als Krönung fordern sie ein »gemeinsames Zugehen auf den Gesetzgeber mit dem Ziel einer Anpassung des Arbeitszeitgesetzes«, also Unterstützung der IG Metall für ihre Forderungen nach Kürzung der Ruhezeiten und danach, »dass die tägliche durch eine wöchentliche Maximalarbeitszeit ersetzt … wird«.[3]
Ende der »Friedhofsruhe«?
Trotz der Absage von Jörg Hofmann an »weitere kollektive wöchentliche Arbeitszeitverkürzung« meinte Margareta Steinrücke (attac), Koordinatorin der Initiative »Arbeitszeitverkürzung jetzt«, auf der Arbeitszeitkonferenz der DKP am 4. November 2017, »durch die Forderungen der IG Metall« habe das Thema 30-Stunden-Woche oder Kurze Vollzeit »neue Aktualität gewonnen«.[4] Diese Einschätzung bestätigen auch meine Erfahrungen aus Diskussionen der letzten Monate, sowohl unter den Vertrauensleuten im »eigenen« Betrieb als auch auf überregionalen IG Metall-Konferenzen. Das Thema »Arbeitszeit« rückt wieder auf die tarifliche Tagesordnung – das öffnet die Tür für Diskussionen um weitergehende Forderungen, besonders vor dem Hintergrund der mit »Industrie 4.0« und anderen Veränderungsprozessen z.B. in der Autoindustrie drohenden Arbeitsplatzverluste. Hängt die aggressive Reaktion von Gesamtmetall vielleicht auch damit zusammen, dass den Unternehmern diese »Gefahr« klarer ist als manchen innerhalb der IG Metall?
Margareta Steinrücke bewertete die IG Metall-Forderungen auch als Ende einer langjährigen »relative(n) Friedhofsruhe in der Frage Arbeitszeitverkürzung«. Wenn wir Verfechter einer »kurzen Vollzeit« für ALLE die neuen Chancen nutzen und die Diskussion weiter vorantreiben wollen, müssen wir auch nach den Ursachen dieser »Friedhofsruhe« fragen. Dazu einige Gesichtspunkte:
Die (west-)deutsche Gewerkschaftsbewegung ist »auf dem Weg zur 35-Stundenwoche steckengeblieben … Angeführt von der IG Metall und der damaligen IG Druck und Papier setzte sich 1984 ein arbeitszeitpolitischer Zug mit dem erklärten Ziel der 35-Stunden-Woche in Fahrt… Doch… den beiden Lokomotiven kamen immer mehr Waggons abhanden, und der Zielbahnhof, die 35-Stunden-Woche, wurde im Jahre 1995 schließlich nur noch in der Metall- und der Druckindustrie erreicht.«[5]
»Die Wochenarbeitszeitverkürzung war nur gegen das Zugeständnis einer weitgehenden Flexibilisierung durchsetzbar… Die zunehmende Entkopplung von Arbeits- und Maschinenlaufzeiten führte… zu vermehrter Schichtarbeit und kompensierte einen Teil der arbeitsplatzschaffenden Effekte… Die Ansätze zur Leistungsbegrenzung konnten die Leistungsverdichtung insbesondere im Bereich der Zeitlöhner und der Angestellten nicht verhindern. Die Wochenarbeitszeitverkürzung verlor auf diese Weise viel von der Attraktivität, die sie Anfang der achtziger Jahre hatte«[6]
Noch stärker »blockiert« (Lehndorff, a.a.O.) scheint der Weg zu weiteren kollektiven Arbeitszeitverkürzungen seit der Niederlage des Versuchs, 2003 in einem Arbeitskampf die Arbeitszeit in der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie an die 35-Stunden-Woche im Westen anzugleichen[7]. Dieser Niederlage auf dem Fuße folgten massive Angriffe von Siemens und anderen Konzernen auf die 35-Stundenwoche und der, oft genug erfolglose, »Häuserkampf« zu deren Verteidigung.[8]
Notwendig: Bewegung in der Gesellschaft
Zu den Ursachen der »Friedhofsruhe« gehört nicht zuletzt auch die sinkende Tarifbindung und das immer stärkere Auseinanderklaffen zwischen tariflicher und untertariflicher Arbeitswelt. Bürgerliche Leitartikler machen damit mobil gegen die IG Metall: »In der Pflege bauen Beschäftigte angesichts knapper Personalschlüssel Überstunde um Überstunde auf, zwei freie Wochenenden im Monat sind da schon Luxus. Ihnen müssen die Forderungen der IG Metall vorkommen wie aus einer anderen Welt. Umso mehr, als die Metaller für die kürzeren Arbeitszeiten auch noch einen Teillohnausgleich durchsetzen wollen. Und das, obwohl die Branche hierzulande mit die kürzesten Arbeitszeiten und höchsten Löhne und Gehälter aufweist.«[9]
Solche Spaltungsmanöver zeigen, ebenso wie die Positionen von Gesamtmetall: auch wenn die Forderungen »bescheidener« sind als 1984, wird doch, ähnlich wie 1984, für einen Erfolg der IG Metall mehr gesellschaftliche Bewegung und Unterstützung notwendig sein als in einem »normalen« Tarifkonflikt. Bei aller Kritik an der Beschränktheit der Forderungen sollte darum allen Linkskräften klar sein: Erfolg oder Misserfolg der IG Metall in der Tarifbewegung 2018 werden mit darüber entscheiden, ob in die gesellschaftliche Diskussion um Arbeitszeiten neue Bewegung hineinkommt oder ob wieder »Friedhofsruhe« einkehrt.
[1] Interview mit Jörg Hofmann, Neue Osnabrücker Zeitung, 4.11.2016
[2] In diversen Interviews, z.B. Neue Osnabrücker Zeitung, 21.10.2017
[3] Diese »moderne« Forderung, »statt des Achtstundentages die 48-Stundenwoche als Obergrenze der wöchentlichen Arbeitszeit festzulegen«, tauchte erstmals im Geschäftsbericht der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände von 1921 (!) auf, vgl. Peter Bartelheimer, »35 Stunden sind genug«, Vorwort Jakob Moneta, Frankfurt/M. 1982, S. 14; Teile dieses Textes stehen auf der Homepage der Bremer Arbeitszeitinitiative: https://www.bremer-arbeitszeitinitiative.de.
[4] UZ, 10.11.2017
[5] Steffen Lehndorff, Weniger ist mehr, Hamburg 2001, S. 19f.
[6] Jürgen Peters (Hg.), In freier Verhandlung, Dokumente zur Tarifpolitik der IG Metall 1945 bis 2002, Göttingen 2003, S. 654
[7] Zu den Gründen dieser Niederlage s. Rolf Knecht, »IG Metall: Der Streik und der Streit«, in: Marxistische Blätter 4–03, Juli/August 2003, S. 8
[8] Vgl. zu diesem Komplex ausführlicher meinen Artikel »Der Streit um Arbeitszeit » in Marxistische Blätter 2–12, auch unter: http://www.schattenblick.de/infopool/medien/altern/marx-519.html – Diese Ausgabe der Marxistischen Blätter zum Schwerpunkt »Kürzer arbeiten« ist insgesamt eine sehr nützliche Lektüre zur Arbeitszeitpolitik!
[9] Frank Specht im Handelsblatt, 14.11.2017
Arbeit 4.0 und Arbeitszeitverkürzung – kurze Vollzeit für alle als Lösung?*
Margareta Steinrücke
1. Bei Arbeit 4.0 denken wir an so unterschiedliche Phänomene wie Roboter, führerlos fahrende Autos, 3D-Drucker, smart home und crowdworker. Im Kern handelt es sich um die neuartige Kombination von Digitalisierung und Automatisierung, die insbesondere massenhaft wiederkehrende gleichförmige Vorgänge unvergleichlich viel schneller erledigen kann als menschliche Arbeiter. Und zwar im Dienstleistungsbereich mindestens so sehr wie in der industriellen Fertigung, weshalb wir nicht mehr von Industrie 4.0, sondern auch von Dienstleistung 4.0 und allgemein von Arbeit 4.0 sprechen. Arbeit 4.0 bezeichnet den 4. Industrialisierungsschub nach der Erfindung der Dampfmaschine, der Einführung von Elektrizität, Verbrennungsmotor und Fließband und der flächendeckenden Nutzung von Computern.
2. Neben der zunehmenden Digitalisierung unseres Alltags, veränderten Beschäftigungsformen und neuen Qualifikationsanforderungen ist insbesondere die Arbeitsplatzentwicklung durch Arbeit 4.0 von Bedeutung. Die Prognosen reichen von 47% Arbeitsplatzabbau (Frey/Osborne) bzw. für Deutschland 54% (IngDiBa) über 15% (IAB) und 12% (OECD) Abbau bis hin zu 400.000 Arbeitsplatzaufbau (Boston Consult). Die für Deutschland plausibelste Studie des IAB untersucht das Ersetzbarkeitsrisiko verschiedener Tätigkeiten nach Qualifikationsstufen. Das für Helfertätigkeiten beträgt 46%, für Fachtätigkeiten 45%, für Spezialistentätigkeiten (Techniker, Meister) 33% und für Expertentätigkeiten (akademische Ausbildung) 19%. Dabei ist das Ersetzbarkeitsrisiko für Männer in den Helfertätigkeiten größer, für die Frauen in den Fachtätigkeiten. Frauen werden insbesondere bei relativ gleichförmig sich wiederholenden Fachtätigkeiten in Büro und Verwaltung, aber auch Einzelhandel betroffen sein.
Aber selbst diese sehr vorsichtige und differenzierte Analyse des IAB kommt zum Resultat von ca. 15% Arbeitsplatzabbau, was allein in Deutschland 4 Millionen Arbeitsplätze sind.
3. Da wir in den hochentwickelten Industrieländern seit Jahren kein Wachstum über zwei Prozent mehr haben (erst darüber hat Wachstum Beschäftigungseffekte) und nach allen Prognosen auch nicht mehr bekommen werden (abgesehen davon, dass es aus ökologischen Gründen auch nicht wünschenswert wäre), wird das Produktivitätswachstum durch Arbeit 4.0 (mehr Produktion pro Arbeitsstunde, in manchen Bereichen bis zu 100%) zu einer gigantischen technologischen Arbeitslosigkeit führen, wenn wir nichts unternehmen.
4. Die einzige realistische Alternative zu diesem Szenario ist eine radikale Arbeitsumverteilung. Flankiert von flächendeckenden Weiterbildungsprogrammen muss die verbleibende Erwerbsarbeit (die ganze unbezahlte, überwiegend von Frauen geleistete, Haus- und Sorgearbeit verschwindet sowieso nicht) auf alle Erwerbsfähigen gleichmäßig verteilt werden. Das bedeutet radikale Arbeitszeitverkürzung für die Vollzeitbeschäftigten und Anhebung der Arbeitszeit für die auf Arbeitszeit Null sich befindenden Erwerbslosen, für Menschen, überwiegend Frauen, in der stillen Reserve, die gerne (wieder) arbeiten würden und für unfreiwillig Teilzeitbeschäftigte.
Nur durch Arbeitszeitverkürzung konnten auch die anderen Technologisierungsschübe in der Geschichte der Industrialisierung ohne dauerhafte Arbeitslosigkeit bewältigt werden. In Deutschland sind wir von der 72-Stunden-Woche 1871 über die 48-Stunden-Woche 1918 und die 40-Stunden-Woche 1963 (nach der Kampagne »Samstags gehört Vati mir!«) bis zur 35-Stunden-Woche in der Metall- und Druckindustrie 1995 gekommen. Seither stagniert die Arbeitszeitverkürzung und ist in bestimmten Bereichen sogar rückläufig.
Durch die gleichzeitige rasante Zunahme von Teilzeitarbeit und Minijobs sinkt die durchschnittliche Arbeitszeit aller Beschäftigten zwar weiter, aber die Arbeitszeiten sind extrem ungleich verteilt in durchschnittlich 43 Stunden bei Vollzeitbeschäftigten (überwiegend Männer) und 19 Stunden bei Teilzeitbeschäftigten (überwiegend Frauen). So haben wir in Deutschland mit 9 Stunden Unterschied zwischen den durchschnittlichen Arbeitszeiten von Männern und von Frauen den europaweit größten Gender-Time-Gap.
5. Eine solche rasante Entwicklung der Produktivität durch neue Technologien und eine entsprechende Anpassung der Arbeitszeit haben schon vor vielen Jahren Ökonomen vorausgesagt, allen voran Karl Marx. Er prognostizierte schon 1858 in seinen »Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie«, dass das Gros der unmittelbaren Arbeit durch die Anwendung von Wissenschaft und Technik in der Maschinerie ersetzt würde, der Arbeiter praktisch neben den Produktionsprozess tritt und nur noch bewachende, wartende etc. Tätigkeiten ausübt und das Gesamtquantum an notwendiger Arbeit radikal sinkt.
Auch der eher für seine Vorschläge zu einer antizyklischen Konjunkturpolitik (Staatsverschuldung für öffentliche Investitionen zur Schaffung von Arbeitsplätzen in der Krise) bekannte John Maynard Keynes hat schon 1930 in einem »Brief an seine Enkel« für das Jahr 2030 die 15-Stundenwoche prognostiziert, wenn wir nicht in einer gigantischen technologischen Arbeitslosigkeit versinken wollen.
Oswald von Nell-Breuning, der Nestor der katholischen Soziallehre, ging 1981 sogar noch weiter: in einem Interview mit Oskar Negt vertritt er die Auffassung, dass wir unseren Lebensstandard sogar mit einer 8-Stunden-Woche halten könnten, wenn wir nur auf alle Verschleiß-, Rüstungs- und Unsinnsproduktion verzichten würden. Die jüngste ökonomisch fundierte Prognose stammt von der englischen New Economics Foundation, die auf Grundlage von volkswirtschaftlichen Berechnungen zum Vorschlag einer 21-Stunden-Woche kommt.
6. Damit könnte zum ersten Mal in der Geschichte der alte Menschheitstraum einer von Mühsal befreiten Gesellschaft wahr werden. Was in der Antike das Privileg weniger war, erkauft durch die Mühen und Leiden der Sklaven, könnte heute allen zugänglich gemacht werden dadurch, dass die schweren und langweiligen Arbeiten von Maschinen bzw. Computern erledigt werden. Darin liegt die riesige Chance, die wir durch Arbeit 4.0 erhalten, die wir allerdings im Interesse aller auch nutzen müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass die sog. digitale Dividende, d.h. das Mehrprodukt, das aus der unvergleichlich viel produktiveren Arbeit 4.0 resultiert, nicht einfach als höhere Gewinne von wenigen Kapitaleignern eingesackt wird, sondern in Form kürzerer Arbeitszeiten gerecht an alle verteilt wird. Eine solche befreite Gesellschaft skizziert Karl Marx im 3. Band des Kapitals: »Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußre Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört; es liegt also der Natur der Sache nach jenseits der Sphäre der eigentlichen materiellen Produktion. Wie der Wilde mit der Natur ringen muss, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, um sein Leben zu erhalten und zu reproduzieren, so muss es der Zivilisierte, und er muss es in allen Gesellschaftsformen und unter allen möglichen Produktionsweisen. Mit seiner Entwicklung erweitert sich dies Reich der Naturnotwendigkeit, weil die Bedürfnisse; aber zugleich erweitern sich die Produktivkräfte, die diese befriedigen. Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin bestehn, dass der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als einer blinden Macht beherrscht zu werden; ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehn. Aber es bleibt dies immer ein Reich der Notwendigkeit. Jenseits desselben beginnt die menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf jenem Reich der Notwendigkeit als seiner Basis aufblühen kann. Die Verkürzung des Arbeitstags ist die Grundbedingung.« (MEW 5, 828).
Eine solche befreite Gesellschaft, in der die Menschen nur noch einen Arbeitstag von 6 Stunden und daneben viel Zeit für künstlerische, wissenschaftliche, sportliche und kommunikative Betätigung haben, hatte bereits 1518 Thomas Morus in seinem berühmten Werk »Utopia« entworfen. Damals war das aber tatsächlich eine abstrakte Utopie, während es heute auf der Grundlage der hochproduktiven Arbeit 4.0 zum ersten Mal eine konkrete, mit ihren Realisierungsbedingungen versehene, Utopie ist. Diese konkrete Utopie hat Ingrid Kurz-Scherf, Prof. em. für Arbeits- und Geschlechterforschung der Universität Marburg, in ihrer »Skizze eines phantastischen Tarifvertrags zum 6-Stunden-Tag« (1987) auf heutige Verhältnisse bezogen ausgearbeitet. Und André Gorz ging in seinem prophetischen Wehauferk »Wege ins Paradies« noch weiter, indem er, kombiniert mit einem Grundeinkommen für jede/n, eine Lebensarbeitszeit von 20.000 Stunden vorschlägt, was bei viel Zeit für Bildung, Sorgearbeit und Ehrenamt zwischendurch eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 20 Stunden bedeuten würde.
7. Eine solche radikal verkürzte Normalarbeitszeit könnte jedem Gesellschaftsmitglied ein Leben in Würde ermöglichen:
- Die Erwerbsarbeit hätte nur noch einen solchen Umfang, dass sie von jedem Menschen ohne gesundheitliche Schäden erledigt werden könnte. Ihre Resultate wären qualitativ besser, weil dank besserer Konzentration und Motivation weniger Fehler passieren würden. Jeder Mensch könnte sich als jemand erleben, der/die einen konstitutiven Beitrag zum Erhalt der Gesellschaft leistet, mit den Anerkennungs- und Einflusschancen, die damit verbunden sind. Dies ist auch ein wesentlicher Grund dafür, warum ein bedingungsloses Grundeinkommen alleine keine Lösung der Probleme von Arbeitslosigkeit und prekärer Beschäftigung darstellt, sondern es parallel einer Umverteilung der gesellschaftlich notwendigen Arbeit auf alle erwerbsfähigen Gesellschaftsmitglieder bedarf.
- Endlich wäre genug Zeit für all die Sorgearbeit. Wir könnten uns mit Zeit, Spaß und in Würde unseren Kindern, Alten, Hilfsbedürftigen, Freundinnen und Freunden widmen, ohne Stress und Einschränkung von Karrierechancen.
- Damit würde erstmals auch die gerechte Aufteilung jeglicher Arbeit, also Erwerbs-, Haus-, Sorgearbeit und Arbeit fürs Gemeinwesen, zwischen den Geschlechtern und dadurch ein gleicher Zugang zu Macht, Geld und Anerkennung möglich.
- Erstmals würde auch Muße, Zeit für erfülltes Nichtstun anstelle von Getriebensein im Hamsterrad für die einen und Verfall der Zeitstruktur und Isolation durch Geldmangel und Scham für die anderen, eine realistische Möglichkeit für alle statt nur das Privileg einer kleinen, von der Arbeit anderer lebenden Minderheit.
- In direktem Zusammenhang damit wäre auch zum ersten Mal in der Geschichte entwickelter Gesellschaften für jede/n Zeit für Kreativität und für politische Teilhabe vorhanden. Anstelle der Monopolisierung künstlerischer und politischer Betätigung durch kleine privilegierte Eliten würde die Entfaltung der künstlerischen, wissenschaftlichen, sportlichen etc. Potenziale einer/s jeden real möglich, könnte an die Stelle von Politikverdrossenheit, u.a. durch schlichte Übermüdung nach einem anstrengenden 8- (mit Wegezeiten und Überstunden 10- bis 12-) Stundentag, die wirkliche Realisierung von Demokratie durch die politische Beteiligung aller treten.
- Und nicht zuletzt wäre der durch eine solche radikale Umverteilung von Arbeit mögliche Abbau der Arbeitslosigkeit, insbesondere der Jugendarbeitslosigkeit, die in Südeuropa katastrophale Ausmaße angenommen hat, aber in verdeckter Form, als prekäre Beschäftigung und Arbeit in der Teilzeitfalle, auch in Deutschland grassiert, die beste Prävention gegen Rechtsextremismus und Islamismus, die sich zu einem großen Teil aus der Perspektivlosigkeit einer ganzen Generation von Jugendlichen und der Angst vor dem Absturz in Arbeitslosigkeit und Armut speisen.
8. Für Ansätze einer solchen radikal verkürzten Normalarbeitszeit für alle hat Helmut Spitzley, der viel zu früh verstorbene Arbeitswissenschaftler und Volkswirt an der Universität Bremen und Forschungsleiter des Bereichs Arbeit am Institut Arbeit und Wirtschaft (IAW) von Universität und Arbeitnehmerkammer Bremen, den Begriff der »Kurzen Vollzeit« geprägt. Dies mit der erklärten Abgrenzung zu ähnlichen Begriffen wie »große Teilzeit«, da diese wegen des Stigmas, das Teilzeit als etwas nicht Vollwertigem, nur für Frauen, der Karriere Abträglichem anhaftet, insbesondere Männer davon abhalten würden, eine solche abgesenkte Vollzeit als Normalarbeitszeit zu akzeptieren. Unter kurzer Vollzeit wird inzwischen landläufig eine Wochenarbeitszeit um die 30 Stunden (mit einer Schwankungsbreite von 25–35 Stunden) verstanden. Und auch wenn die deutschen Gewerkschaften derzeit nicht an vorderster Front bei der Forderung nach einer solchen neuen Normalarbeitszeit stehen, gibt es doch eine ganze Reihe beachtenswerter Ansätze und Vorschläge zu einer kurzen Vollzeit.
Der wohl bekannteste dürfte der Vorschlag der Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig zu einer Familienarbeitszeit von 32 Stunden bzw. 80% der üblichen Vollzeitarbeitszeit für berufstätige Eltern kleiner Kinder sein, wenn diese beide ihre Erwerbsarbeit absenken. Dieser Vorschlag ist aber zunächst nur auf die Gruppe der Eltern beschränkt.
Jutta Allmendinger, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) plädiert dagegen für eine 32-Stunden-Woche für alle, Männer wie Frauen, Eltern wie Nichteltern, weil nur so die Chancen zwischen den Geschlechtern gerechter verteilt und die ungehobenen Fachkräftereserven der Frauen mobilisiert werden könnten.
Weltweit Aufmerksamkeit erregt hat das Experiment mit dem 6-Stunden-Tag in Göteborg. Dort durften die Beschäftigten der kommunalen Altenpflege und des OP einer orthopädischen Klinik sechs statt acht Stunden arbeiten, bei vollem Lohnausgleich und Neueinstellung von zusätzlichen Beschäftigten. Die Resultate waren ein sinkender Krankenstand, Beschäftigte, die so fit nach Hause kamen, dass sie noch Lust hatten, mit ihren Kindern zu spielen, alte Menschen, die von der Freundlichkeit und Zugewandtheit der Pflegenden begeistert sind, 20% mehr Operationen und der Abbau der Wartelisten dafür.
In Frankreich setzen sich die große Gewerkschaft CGT und der sozialistische Präsidentschaftskandidat Benoit Hamon für die 32 Stundenwoche ein, in Belgien die beiden großen sozialistischen und katholischen Gewerkschaftsbünde. In Österreich sprechen sich die beiden großen Gewerkschaften GPA und ProGe für die 35-Stunden-Woche jetzt und die 30-Stunden-Woche perspektivisch aus, während der neue sozialdemokratische Bundeskanzler Christian Kern schon bei Amtsantritt für radikale Arbeitszeitverkürzung und die Einführung einer Maschinensteuer plädiert hat, was sein Arbeitsminister Alois Stöger jetzt zur Forderung einer 36-Stunden-Woche konkretisiert hat. In Deutschland hat die IG Metall im Herbst 2016 eine große Arbeitszeitinitiative ins Leben gerufen. Sie hat zwar erst einmal zum Ziel, die ausufernden Arbeitszeiten wieder auf die tarifvertraglich vereinbarten 35 Stunden pro Woche einzufangen. Aber in ihren eigenen Umfragen zeigt sich eine nicht unerhebliche Zahl von Beschäftigten der Metallindustrie interessiert an einer kurzen Vollzeit zwischen 28 und 34 Stunden. Perspektivisch wird vermutlich auch die IG Metall solche Wünsche in ihr Kalkül mit aufnehmen müssen.
Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di mit ihren über 100 verschiedenen Arbeitszeittarifverträgen, in denen zwischen 34 und 41 Wochenstunden alles vorkommt, hat einen Vorschlag zu 14 Tagen Verfügungszeit für alle (auf die Woche umgerechnet etwa 2 Stunden weniger) als einen ersten Schritt zu einer kurzen Vollzeit entwickelt. Mit einer europäischen Perspektive fordert attac Deutschland die 30-Stunden-Woche für Europa mit vollem Lohn- und Personalausgleich. Die AG ArbeitFairTeilen von attac-D hat zusammen mit dem Collectif Roosevelt, das in Frankreich in Aktualisierung von Franklin D. Roosevelts New Deal eine große Kampagne zur Arbeitszeitverkürzung gestartet hat, mit einer Konferenz in Brüssel im Oktober 2016 die Initiative zu einer europäischen Vernetzung aller am Projekt Arbeitszeitverkürzung arbeitenden Organisationen und Gruppen ergriffen. Mit 40 beteiligten Organisationen aus 7 europäischen Ländern war die Resonanz sehr gut und soll in einem Netzwerk zum Austausch und zur Abstimmung über die verschiedenen Ansätze und Strategien der Arbeitszeitverkürzung in Europa fortgeführt werden.
* Vortrag auf der Bremer Arbeitszeitkonferenz, Mai 2017
Storytelling im Betrieb
Wie Unternehmen die Digitalisierung umsetzen wollen
Marcus Schwarzbach
Demokratie im Betrieb, Selbstbestimmung und Vertrauen für die Arbeitnehmer verspricht die digitale Arbeitswelt. »Der Acht-Stunden-Tag bei einer ununterbrochenen Ruhepause von mindestens 36 Stunden in jeder Woche, bessere Hygiene- und Schutzmaßnahmen in der Fabrik und ein Ende der Kinderarbeit – so sah früher einmal eine Vision der Arbeit von Morgen aus. Heute gibt es neue Bilder davon, wie wir gerne arbeiten möchten: Da ist der kreative Wissensarbeiter, der am See sitzt, den Laptop auf dem Schoß. Oder die Arbeiterin in der Produktion, die per App ihre gewünschten Schichtzeiten für die nächste Woche in den Organisationsplan einträgt.«[1] Mit diesen Versprechen wird das »Weißbuch Arbeiten 4.0« des Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) eingeleitet.
Große Worte zur Digitalisierung fallen auch in anderen Bereichen: Als die »Geschichte eines demokratischen Unternehmens« wird die Entwicklung der IT-Agile GmbH beschrieben (siehe http://ww.brandeins.de/archiv/2014/arbeit/it-agile-softwareentwicklung-demokratische-firma-cool-und-beaengstigend). »Mehr Vertrauen, mehr Verantwortung, mehr Selbstbestimmung« für die Beschäftigten verkündet Professor Carsten Schermuly von der SRH Hochschule Berlin.[2] Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt. Viele Arbeitsprozesse sind heute nicht mehr mit einer zentral durchdachten Steuerung regelbar. Bisher klare Anweisungen für einzelne Arbeitsabläufe oder Genehmigungsverfahren beim direkten Vorgesetzten werden durch neue Managementkonzepte abgelöst.
New Work
Neue Konzepte sollen die Veränderungen im Unternehmensinteresse steuern. Vor allem »der dynamische Wandel, die Vernetzung, die Unsicherheit und dazu gut ausgebildete und mündige Mitarbeiter, die wissen, wie wertvoll ihre Expertise ist« machen Modelle wie »New Work« erforderlich, so Schermuly: »New Work heißt nicht einfach flache Hierarchien«. Vielmehr müsse sich die Rolle der Führungskraft radikal ändern. Wer Strukturen in einem Unternehmen verändern will, müsse gleichzeitig »die Strukturen in den Köpfen der Menschen verändern, die in diesen Strukturen arbeiten«. Eine Führungskraft sei nicht mehr der Chef einer Abteilung, denn Teams sollen in Netzwerkstrukturen projektbasiert gebildet werden.
»Auf Führungskräfte, deren Führungsverständnis darin besteht, andere Menschen zu kontrollieren«, müsse verzichtet werden.[3] Führungskräfte seien »Teil des Teams« und haben jetzt die Rolle des Moderators. Denn das »Arbeiten in Netzwerken kann nicht kontrolliert und beherrscht werden. Netzwerke organisieren sich selbst«. Die Führungskraft könne lediglich Rahmenbedingungen schaffen, damit »das Netzwerk optimal arbeiten kann. Sie ist die Hebamme, die mit ihrer Prozesserfahrung die Arbeit so organisiert, dass neues Wissen von den Mitarbeitern geboren werden kann«. Das sei zum Vorteil aller: »Das Schöne an der modernen Form der Organisation ist, dass nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die meisten Führungskräfte ihre Arbeit als sinnvoller erleben werden«, verspricht Schermuly, der Autor des Standardwerks »New Work – Gute Arbeit gestalten«.
So positiv ist es aber nicht unbedingt, wie ein Beispiel zeigt. Einen wichtigen Ansatz der Arbeitsgestaltung im Sinne von New Work sieht Schermuly in der »Holacracy« (auf deutsch: Holokratie). Der Name leitet sich vom griechischen Begriff »Holon«, der mit »das Teil eines Ganzen« übersetzt werden kann, ab. Ähnlich dem menschlichen Körper sei dabei eine Zelle »eine eigenständige Einheit, die mit anderen Einheiten zusammen ein Organ« bildet.[4] In der digitalen Arbeitswelt soll diese Logik zu gravierenden Änderungen führen. »Traditionelle Stellenpläne gibt es bei Holacracy nicht. Kontinuierlich wird das Unternehmen verändert und alle Mitarbeiter und Unternehmensteile werden dabei einbezogen«. Beschäftigte sollen so keine Sicherheiten mehr haben, sondern regelmäßigem Wandel unterliegen. Das gerade diese häufigen Veränderungen Arbeitnehmern Probleme bereiten, da sie sich kaum noch auf Neuerungen am Arbeitsplatz einstellen könne, wird ignoriert. »Nichts soll der Arbeit in den Weg kommen. Vor allem keine statischen Positionen mit ihren schnell veralteten Stellenbeschreibungen.«
Etwas verklausuliert betont Schermuly, es finde »dezentrale Organisationsentwicklung statt, die einen evolutionären Charakter besitzt«. Holacracy verändere die »Gesamtstruktur eines Unternehmens«, denn »Hierarchien, Führungspositionen und Titel werden radikal abgeschafft«. Er macht deutlich: die bisherigen Tätigkeiten verlieren bei diesem System an Bedeutung. »Ein Mitarbeiter kann verschiedene Rollen übernehmen. Wenn eine Rolle zu komplex wird, dann bildet sich eine neue«, so der Ansatz. »Die Mitarbeiter entkommen der Hierarchie und den peniblen Kontrollmechanismen klassischer Unternehmensstrukturen. Das bringt mehr Selbstbestimmung und Einfluss. Da die Arbeitsaufgaben und nicht starre Stellenprofile im Fokus stehen und die Mitarbeiter Einfluss haben, welche Rollen sie übernehmen, kann Holacracy auch das Bedeutsamkeitserleben stimulieren«. Deutlich benennt Schermuly den Veränderungsbedarf bei dem Personenkreis der »ehemaligen Führungskräfte«. Denn diese »müssen normale Rolleninhaber werden oder das Unternehmen verlassen«. Wer mit dieser Härte gegenüber Vorgesetzten agiert, wird mit Arbeitnehmern, die weniger flexibel sind, auch nicht humaner umgehen. So erscheint »New Work« nur als anderer Begriff für das amerikanische »Hire and fire«.
Demokratie im Betrieb
Das Management müsse lernen, »dass Befehl und Gehorsam« nicht mehr funktioniere, betont Unternehmensberater Thomas Sattelberger: »Der Mitarbeiter ist kein unmündiges, zu schützendes und zu kontrollierendes Wesen mehr, sondern ein souveräner, eigenverantwortlicher Akteur. Das Ich betritt wieder den Platz«. Das sei nur durch »Demokratie im Betrieb« umsetzbar, die allerdings ein neues Führungsverständnis voraussetze, argumentiert der frühere Vorstand der Telekom, der inzwischen als FDP-Bundestagsabgeordneter Einfluss auf die Gesetzgebung nimmt. Er hat einen Bestseller über »Das demokratische Unternehmen« verfasst.[5] »Demokratische Unternehmen experimentieren mit Führung auf Zeit«, lassen Beschäftigte Führungskräfte wählen, die dann abwählt werden können. Das gebe den »Menschen die Möglichkeit, Unternehmensentwicklung zu debattieren, sie zu beeinflussen oder gar über die Unternehmensentwicklung zu entscheiden.
Beispiele für »Demokratie im Unternehmen«
Der Personaldienstleister Haufe-umantis wird häufig als Vorreiter der »Demokratie im Unternehmen« präsentiert. Auf Initiative des Firmengründers Hermann Arnold stellten sich alle Führungskräfte »dem Votum durch ihre 120 Mitarbeiter. 25 Kandidaten, angefangen mit CEO Marc Stoffel, standen für 21 führende Positionen zur Wahl. Dabei wurden elf Vorgesetzte in ihrer Position bestätigt, sieben Mitarbeiter in das Management befördert. Drei Stellen werden extern besetzt; eine Führungskraft wurde abgewählt«, berichtet die Wirtschaftswoche.[6] Eine Folge sei, dass die Arbeitnehmer »motivierter und auch glücklicher sind, wenn sie sich in Entscheidungen einbringen können«, betont ein Sprecher des Unternehmens. Wichtig ist dabei auch die Außenwirkung. Andere Unternehmen haben »ein großes Interesse an einem Wandel des Verhältnisses und der Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern«. Dies wirke nicht zuletzt auf Kunden des Personaldienstleisters, betont Haufe-umantis-Sprecher Bernhard Münster.
Diesen Werbeeffekt will auch die Deutschen Telekom nutzen. »Wir arbeiten seit vier Jahren in einer Projektorganisation mit agilen Teams. Eigenverantwortliches Arbeiten der Kolleginnen und Kollegen ist dabei sehr wichtig. Da kam mir irgendwann die Idee, dass sie eigentlich konsequenterweise in die Entscheidungsfindung mit einbezogen werden müssten«, erläutert Philipp Schindera, Leiter der Unternehmenskommunikation der Deutschen Telekom. Unter dem Motto »wahlen@com« haben 140 Beschäftigte vier »Mitarbeiter-Vertreter« in den Führungskreis gewählt.[7] »Viele bewundern unseren Mut«, betont Schindera. Ziel sei »Mehr Transparenz bei der Entscheidungsfindung«. Die Vertreter der Belegschaft können bei den anstehenden Planungen mitwirken und haben die »gleichen Rechte und Pflichten wie die anderen Mitglieder des Führungskreises«. Klar ist aber auch: Personal- und Budgetthemen sind ausgenommen. »Hermann Arnold, der Mitgründer von Haufe-umantis, hat es auf den Punkt gebracht: Mitarbeiterwahlen sind am Ende vor allem ein Feedbacktool«, fasst Schindera das Vorgehen zusammen und macht deutlich, dass es um die Inszenierung von Beteiligung oder um Marketing geht – und weniger um demokratische Entscheidungen im Betrieb.
»Anpassungen in der Gesetzgebung« als Voraussetzung
Sattelberger benennt offen seine eigentliche Zielsetzung im Rahmen der Diskussion um »demokratische Unternehmen«: »Dafür braucht man Anpassungen in der Gesetzgebung: im Sozialversicherungsrecht, im Arbeitsrecht, im Arbeitsschutz und im Betriebsverfassungsrecht«. Bereits vor der Bundestagswahl formulierten Unternehmensvertreter klare Forderungen: »Wenn wir die Chancen der Digitalisierung nutzen, sichern wir Wohlstand und Beschäftigung in Deutschland«.[8] »Grundvoraussetzung für die Transformation« sei aber Veränderungsbereitschaft »in Unternehmen und mit Blick auf Regulierung«, so die Vertreter von BMW, Bayer-Konzern, Münchener Rückversicherung und Telekom.
Formal werden die Vorgaben durch die »Deutsche Akademie der Technikwissenschaften« (Acatech) im Positionspapier »Arbeit in der digitalen Transformation« vorgebracht. Was nach wissenschaftlicher Analyse klingt, ist entschlossene Interessenvertretung im Sinne der Kapitalvertreter. Acatech ist ein staatlich geförderter privater Verein, der auch durch Unternehmensspenden finanziert wird.[9] Die Erwartungen an Gewerkschaften und Betriebsräte werden klar geäußert: »Im Sinne einer ganzheitlichen Verantwortung ist die deutsche Mitbestimmung seit jeher Garant dafür, unternehmerische Interessen und Belange der Beschäftigten in Einklang zu bringen«. Gleichzeitig sei der Gesetzgeber bei der »Anpassung der Mitbestimmung« gefordert. Regelungen zur Mitbestimmung bei digitaler Technik müssen »flexibilisiert werden«, die »zukünftige Mitbestimmungskultur muss auch »loslassen« können«. Bei der Digitalisierung gehe es um eine grundlegende Umgestaltung der Arbeitsbedingungen. Angestellte »können ihre Arbeit flexibler, selbstbestimmter, eigenverantwortlicher und kreativer gestalten«, versprechen die Autoren. Dies sei nur möglich, wenn bestehende Gesetze eingeschränkt werden. »Die heutigen Arbeitszeitregelungen stammen größtenteils noch aus dem Industriezeitalter« und dürfen so nicht weiterbestehen.
Crowdworking als Werkverträge der Zukunft
Die Autoren gehen aber noch einen Schritt weiter. Verstärkt sollen Werkverträge zum Einsatz kommen, also die »Flexibilität moderner Arbeitsformen« genutzt werden. »Ein neues Verständnis von Arbeit« ist »Grundvoraussetzung für die Transformationsfähigkeit von Unternehmen«. Crowdworker sollen »keineswegs nur für einfache Mikroaufgaben, sondern auch für anspruchsvollere Problemlösungen genutzt werden«. Sie sollen als »Teammitglieder temporär integriert« und so gegen Angestellte in Konkurrenz gesetzt werden. Negative Auswirkungen auf die Belegschaften werden dabei nicht thematisiert. Denn selbst wenn der Arbeitnehmerstatus erhalten bleibt, kann sich gerade Homeoffice, also das Arbeit von zuhause, negativ auf die Beschäftigten auswirken. »Selbstbestimmung klingt gut, ist aber auch eine Einladung zur Selbstausbeutung«, fasst die Hans-Böckler-Stiftung Befragungen von Beschäftigten zusammen. Eine aktuelle Studie der gewerkschaftlichen Stiftung bestätigt die Gefahren für die Gesundheit, vor allem durch fehlende Trennung zwischen Arbeit und Freizeit: »Wer im Homeoffice tätig ist, kann abends oft nicht abschalten. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 45 Prozent und damit mehr als doppelt so hoch wie bei Beschäftigten, die nie zu Hause arbeiten. Offenbar verschwimmen die Grenzen zwischen den Lebensbereichen bei dieser Arbeitsweise besonders leicht«.[10]
Da die Digitalisierung »neue Arbeitsmöglichkeiten« beinhalte, ein Arbeiten zu jeder Zeit und an jedem Ort ermögliche, spricht Sattelberger von der »Souveränität« der Beschäftigten. »Die Mitarbeiter haben eine Stimme, was die Arbeitszeit, den Arbeitsort, Kollaborationsformen, den Arbeitsstil und den Arbeitsinhalt betrifft«. Es gehe »um selbstbestimmte, gegebenenfalls ausgehandelte Antworten des Einzelnen«, die sich aber nicht nur auf die Arbeitszeit oder den Arbeitsort beziehen, sondern auch auf die Frage: Arbeitsverhältnis oder Werkvertrag, etwa in Form von Crowdworking. Crowdworking-Plattformen wie »Clickworker« sind die Vorboten einer neuen Arbeitsorganisation. Bei den Internetmarktplätzen für Arbeit ist die Macht klar auf Seiten der Auftraggeber. Bezahlt wird oft nur, wer zuerst eine Lösung einreicht, die den Anforderungen des Auftraggebers entspricht. Das Zerlegen von Arbeit in kleine und zumeist einfache Tätigkeiten ermöglicht es den Auftraggebern, auf eine Unmenge an Anbietern zurückzugreifen, die sich weltweit unterbieten.
Bereits jetzt geben Fachzeitschriften Personalabteilungen Praxistipps. »Crowdworking ist derzeit in der Arbeitswelt noch eine kleine Nische«, erläutert das Personalmagazin. Die Diskussion »Crowdwork als Arbeitsvertrag oder Preisausschreiben?« wird ergänzt um konkrete Formulierungsvorschläge für Verträge. So muss »durch Klauseln zur Geheimhaltung und Löschung der Arbeitsergebnisse beim Crowdworker sichergestellt« werden, dass Arbeitsergebnisse »vertraulich behandelt und nicht für eigene Zwecke« verwertet werden, warnt Rechtsanwalt Dietmar Heise.[11] Der Online-Händler Amazon schafft bereits Fakten und setzt im Weihnachtsgeschäft zusätzlich auf Solo-Selbstständige: Der Crowdworking-Vorreiter setzt mit »Amazon Flex« private Fahrer ein, die über eine App gesteuert werden. Sie sollen im Auftrag von Amazon Pakete mit ihrem eigenen Auto ausliefern. Hierzulande startet Amazon Flex derzeit nur in Berlin, während dies in den USA, England und Singapur bereits länger funktioniere. Nach eigenen Angaben habe Amazon dort »Tausende Partner«, die in der Crowd verfügbar seien.[12]
Uber sieht Sattelberger als positives Beispiel. »Uber muss heute mit den Normierungen des tradierten Arbeitsrechts und des Personenbeförderungsgesetzes umgehen. Die andere Frage ist: Müsste das Recht sich nicht öffnen?« Als Konkurrenz zu Taxifahrern soll jeder Nutzer andere im Fahrzeug mitnehmen können. Das Internet sorgt so für Dumping-Konkurrenz zur Taxibranche, denn die niedrige Bezahlung sowie die fehlende Sozial- und Unfallversicherung ermöglichen niedrige Preise. Uber werde »zum tauglichen Geschäftsmodell«, betont dagegen der frühere Telekom-Vorstand. Von Protesten der Uber-Fahrer völlig unbeeindruckt, lobt er die Online-Plattform.
Das gesunde Unternehmen nur als Ankündigung
Inwieweit die eigentlichen Interessen ungenannt bleiben, zeigen Sattelbergers Darstellungen über »das gesunde Unternehmen«. Denn Gesundheitsschutz im Betrieb sei ein weiteres Element des »demokratischen Unternehmens«: »Wo auf gesellschaftlicher Ebene, Begriffe wie Glück oder erfülltes Leben wichtiger werden«, gehe es im Betrieb »z.B. um das Ausbalancieren von Belastungen bei der Arbeit, die Verteilung des Erwirtschafteten auf die Stakeholder und das organische Zusammenwirken von Wirtschaft und Gesellschaft«. Die Realität der digitalisierten Unternehmen sieht anders aus: Dem DGB-Index Gute Arbeit zufolge müssen 27 Prozent der Beschäftigten sehr häufig oder oft nach Dienstschluss erreichbar sein. Dies widerspreche den gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten, die grundsätzlich elf Stunden ohne Unterbrechung betragen müssen, betont Tanja Carstensen, Soziologin von der TU Hamburg-Harburg. »Erreichbarkeit« gelte zwar nicht generell als Arbeitszeit. So wie bei der Rufbereitschaft stelle jedoch jede Arbeitsaufnahme – und sei sie noch so kurz wie etwa das Lesen einer beruflichen Mail – eine Unterbrechung der Ruhezeit dar. Eine von ver.di veröffentlichte Sonderauswertung der Arbeitsbedingungen in der IT-Dienstleistungsbranche – die Vorzeigebranche bei digitaler Arbeit – zeigt: Die Belastungen nehmen durch eine hohe Arbeitsintensität und Anforderung an ständige Erreichbarkeit zu.[13] Cloudworking, das Arbeiten in der Wolke quasi, ermöglicht ein Arbeiten unabhängig von Zeit und Raum. »Ein wesentlicher Unterschied zur traditionellen Arbeit, beispielsweise in einer Fabrik, besteht in der Fragmentierung der Arbeit und damit der Schwierigkeit, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Wenn man gar keinen Zugriff mehr auf die wesentlichen Produktionsmittel hat, dann wird die Macht der Arbeiter zerschlagen«, berichtet Silvio Lorusso vom Institut für Netzwerkkulturen der Universität Amsterdam.[14]
Frontalangriff auf Gewerkschaften
»Das Schöne an der modernen Form der Organisation ist, dass nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die meisten Führungskräfte ihre Arbeit als sinnvoller erleben werden«, verspricht Carsten Schermuly.[15] Thomas Sattelberger will deshalb nicht mehr von »Angestellten« sprechen, sondern von »Unternehmensbürgern«.[16]
Er betont die große Bedeutung des »Individuums« in den Unternehmen. »Meine Vision ist, dass die Welt der Arbeit um einen zukunftsfähigen Akteur reicher wird. Dieser Akteur ist das Individuum.«. Und macht deutlich, gegen wen sich dieser Ansatz richtet: »Betriebsräte und Gewerkschaften müssen lernen, dass die Unmenge an Schutzrechten in den Zeiten des industriellen Turbo-Kapitalismus nötig war, im Übergang zur digitalisierten Ökonomie jedoch zunehmend untauglich oder gar kontraproduktiv ist«.
Denn das »Individuum als Subjekt spielt in der Arbeitswelt noch kaum eine Rolle. Der einzelne Mitarbeiter wird entweder geschützt oder kontrolliert – als Objekt«. Gewerkschaften und Betriebsräte agieren nur »mit Schutzrechten«. Sattelberger will dies ändern. Denn »das ist Entmündigung«. Gefordert sei deshalb auch der Gesetzgeber. »Damit diese Entwicklung eine Dynamik entfaltet, muss der gesetzliche Rahmen angepasst werden, der immer noch sehr betriebszentriert ist. In der Realität wird es den klassischen Betrieb immer seltener geben. Der Trend Industrie 4.0 entgrenzt das Unternehmen räumlich und zeitlich. Die Wertschöpfung endet nicht mehr an Unternehmensgrenzen, sondern verbindet eine Vielzahl von Unternehmen«.
So zeigt sich, dass die Erzählungen von »Demokratie im Betrieb« oder »Selbstbestimmung für Beschäftigte« nur ein Ziel haben: Durch dieses Storytelling soll die Digitalisierung im Unternehmensinteresse durchgesetzt werden.
[1] Weißbuch Arbeiten 4.0, Seite 4, siehe: https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a883-weissbuch.pdf?__blob=publicationFile&v=4#5
[2] Siehe https://www.haufe.de/personal/hr-management/new-work-moderne-formen-der-arbeitsgestaltung/agile-methoden-zur-arbeitsgestaltung_80_406702.html
[3] https://www.haufe.de/personal/hr-management/new-work-moderne-formen-der-arbeitsgestaltung/new-work-arbeiten-in-dynamischen-netzwerken_80_406700.html
[4] Siehe: https://www.haufe.de/personal/hr-management/new-work-moderne-formen-der-arbeitsgestaltung/holacracy-die-holokratische-organisation_80_406704.html
[5] Die Zitate von Sattelberger stammen, soweit keine andere Anmerkung vorliegt, aus: Seite 17ff. aus: Thomas Sattelberger/Isabell Welpe/Andreas Boes, Das demokratische Unternehmen: Neue Arbeits- und Führungskulturen im Zeitalter digitaler Wirtschaft, Haufe Verlag.
[6] Siehe: http://www.wiwo.de/erfolg/management/demokratie-im-unternehmen-wenn-chefs-gewaehlt-werden/9469354.html
[7] Siehe www.haufe.de/personal/hr-management/unternehmensdemokratie-fuehrungskraeftewahlen-bei-der-telekom_80_400928.html
[8] Sämtliche Zitate zu Acatech stammen aus: Acatech, »Arbeit in der digitalen Transformation – Agilität, lebenslanges Lernen und Betriebspartner im Wandel« http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Publikationen/acatech_diskutiert/170609_DISKUSSION_HR-Kreis_WEB.pdf
[9] Siehe www.acatech.de – Knapp zehn Jahre war der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog ihr Sprecher und Förderer. Acatech hat die »Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0« im Auftrag der Bundesregierung erarbeitet, ihre Veröffentlichungen finden bei Regierungspolitikern Gehör.
[10] »Im Homeoffice oder mit völlig selbstbestimmten Arbeitszeiten fällt Abschalten besonders schwer – klare Regeln für Flexibilität nötig«, im Internet: https://www.boeckler.de/14_110305.htm
[11] Siehe http://www.haufe.de/personal/zeitschrift/personalmagazin/personalmagazin-102016-personalmagazin_48_381028.html
[13] Siehe Schwarzbach, Work around the clock? Seite 40
[14] junge Welt vom 10.5.2017 Der Startup-Kult ist eine religiöse Geschichte.
Editorial
Irrationalismus ist nicht bloßer Irrtum. Er ist Leugnung der Erkennbarkeit der Welt, aktiver Angriff auf Aufklärung und Humanismus, Zerstörung der Vernunft. Zugleich ist er notwendige ideologische Konsequenz sozialer Verhältnisse, die der Masse der Menschheit keine Perspektive jenseits von Ausbeutung, Verelendung und Kriegsgefahr zu bieten haben. Als Geist geistloser Zustände ist er Grundzug aller Formen spätbürgerlicher Ideologie. Die Autoren unseres Schwerpunkts nähern sich diesem ungeheuer vielschichtigen Themenkomplex aus unterschiedlichen Perspektiven.
Bezugnehmend auf Georg Lukács bemüht sich Claudius Vellay um Klärung erkenntnistheorietischer und ontologischer Grundlagen, grenzt Irrationalismus ab von Unvernunft und Vernunftlosigkeit. In diesem Zusammenhang berücksichtigt er entscheidende Entwicklungen in Lukács Werken.
Werner Seppmanns Beitrag thematisiert soziologische und sozialpsychologische Ursachen erfolgreicher Verbreitung rechtsextremen Gedankengutes. Er untersucht die Frage, wieso auch und gerade in proletarischen Bevölkerungsschichten, die von Gruppierungen wie der AfD nichts als weitere soziale Deklassierung zu erwarten haben, antihumanistische Weltdeutungsangebote auf fruchtbaren Boden fallen.
Daniel Bratanovic watet durch jenes uferlose Sumpfgebiet, in dem Geistheiler, Chemtrail-Analysten, Lichtgurus und Illuminatenjäger ihr Unwesen treiben. Er findet dort nicht bloß verwirrte Individuen, sondern ein ideologisches Korrelat der objektiven Verfallserscheinungen der »neoliberalen« Epoche – mit Risiken und Nebenwirkungen auch für progressive Bewegungen.
Religiöse Vorstellungen prägen das Denken von Milliarden, behaupten in vielen Weltgegenden unangefochten ihre ideologische Hegemonie, auch durch die Verzahnung religiöser und staatlicher Apparate. Ferne Vergangenheit für Deutschland? Holger Wendt meldet hier Zweifel an, thematisiert das gedeihliche Verhältnis von Großkirchen, Staat und »Neoliberalismus«.
Die akademische Volkswirtschaftslehre ist eine Religion eigener Art. Klaus Wagener widmet seinen Aufsatz einer Wissenschaft, die sich selbst als wertfrei anpreist, aber keinen höheren Wert kennt als die Maximierung des Profits. Wagner skizziert den Verfallsprozess der bürgerlichen Ökonomie von den Höhen ihrer klassischen Periode bis hinab ins Jammertal einer Pseudowissenschaft, die jedwedes Erkenntnisinteresse zugunsten bedingungs- und begriffsloser Apologetik aufgegeben hat.
Die »Nationalsozialistische Weltanschauung« trieb das jeder antiaufklärerischen Bestrebung innewohnende mörderische Potenzial auf die Spitze. Am Beispiel faschistischer Deutungen der Oktoberrevolution untersucht Valentin Hemberger die Konstruktion politischer Mythen. Ideologeme wie die »jüdische Weltverschwörung« oder die »Bedrohung Europas durch die asiatische Despotie« erwiesen ihre Funktionalität für gegenrevolutionäre und imperialistische Politik; ihre Wirksamkeit überdauerte das Jahr 1945.
Als grundlegendes Merkmal der imperialistischen Epoche durchzieht die Feindschaft gegen die Vernunft alle Bereiche intellektueller Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, selbst in derjenigen Kunstform, die »am entferntesten (…) von der Welt der praktischen Dinge« ist. Ausgehend von den theoretischen Ansätzen Hans Eislers diskutiert Georg Klemp die Frage nach der »Dummheit in der Musik«.Holger Wendt
Die Herabsetzung der Vernunft
Ein Streifzug durch die Irrationalismen dieser Tage
Daniel Bratanovic
Aluhüte schützen, Bachblüten heilen und Chemtrails schaden. Verschwörungssimpel können erheitern, Esoteriker befremden und Zeloten aller Schattierungen nerven. Die Spanne irrationaler Absonderungen ist breit, Performance, Welterklärungsansätze und angepriesene Mittel verschieden. Einst ließen sich die Scharlatane, Quacksalber und Kurpfuscher noch als Jahrmarktsattraktionen bestaunen. Heute hingegen besteht der Rummel – durchaus eine reale Metapher wirklicher Verhältnisse – vor allem aus immer schnelleren und größeren Maschinen, die den Besucher so erbarmungs- wie sinnlos im Kreis drehen, durch die Luft wirbeln, in die Höhe katapultieren und jäh wieder abstürzen lassen.
Die Vertreter der Zunft haben mittlerweile ihren eigenen Jahrmarkt. Auf regelmäßig wiederkehrenden Esoterikmessen bieten Geistheiler Lebensberatung, deuten Astrologen die Sterne, vermitteln Hellseher Jenseitskontakte, verkaufen Handleser handgefertigte Engelanhänger oder werben Feng-Shui-Meister für Reinkarnationstherapien auf einer Magic-Power-Liege. Dem praktizierten Unfug, mit dem diese buntscheckige Armee des perennierenden Schwachsinns die Welt behelligt, dürfte jenseits aller tatsächlich empfundenen oder bloß vorgegaukelten Spiritualität ein ziemlich materieller Zweck zugrunde liegen: Den Verzweifelten und Naiven, die sich an solche Orte verirren, das sauer verdiente Geld mit dem Versprechen auf Besserung ihres elenden Daseins zu entlocken.
Der therapeutische Okkultismus, den die professionelleren Nachfahren der Afterärzte und Urinpropheten in ihren allerorten anzutreffenden Gemeinschaftspraxen für kinesiologische und alternative Medizin oder Zentren für anthroposophische, fernöstliche, geomantische und energetische Ernährungs-, Raum- und Lebensberatung im Angebot haben, behauptet, er führe auf den »Pfad zur inneren Einheit«, garantiert dem Ratsuchenden, er werde sich »mit sich selbst in Einklang« bringen können. Wer »Harmonie« und »innere Balance« bei einem Lichtguru oder einem Reikimeister zu finden hofft, der spürt zumindest, dass etwas nicht stimmt mit ihm. Solche auf Aberglaube gründende Heilkunst enthält das noch stets uneingelöste, selbstverständlich so nicht formulierte Versprechen, die geplagten Subjekte mit ihrer gesellschaftlichen Objektivität zu versöhnen. Das eigene Scheitern und die gefühlte innere Zerrissenheit werden dabei jedoch niemals in Verbindung mit den äußeren Verhältnissen gebracht, immer soll der Fehler im eigenen Selbst gesucht werden.
Die abverlangte Eigenverantwortlichkeit entspricht nur allzu sehr dem neoliberalen Idealbild des unternehmerischen Individuums, das sich mittels Autosuggestion und Selbstregulierung optimieren und damit den Imperativen der modernen Arbeitswelt bereitwillig unterwerfen soll. Der esoterische Irrationalismus, dem jede Vermittlung, jeder Verweis auf Zusammenhänge, jeder wissenschaftliche Zugang zu biologischen und sozialen Prozessen fremd, ja Feind ist, erweist sich, so absurd er auch erscheinen mag, gerade deswegen als ein Komplize des reibungslosen Betriebsablaufs kapitalistischer Gesellschaften, insofern sich deren Subjekte im Falle einer erfolgreich verlaufenen Kur zur Selbstfindung als dann innerlich aufgeräumte Ich-AGs der alltäglichen Konkurrenzsituation zu stellen vermögen.
Diese offen irrationale, aber im Rahmen zweckrationaler Vergesellschaftung funktionale Praxis, die das beschädigte Leben des atomisierten Einzelnen im Verhältnis zu seiner Umwelt regelt, ist für sich genommen noch keine Politik, sondern Privatangelegenheit und deshalb auch im Wortsinne esoterisch. Zwar spielt solcher okkulte und spirituelle Wahnsinn in der Sphäre der Öffentlichkeit keine Rolle, doch irrational geht es dort trotzdem zu, und je länger die gesellschaftliche Krise anhält, desto größer das Ausmaß der Unvernunft. Niemand scheint angesichts der Zahl seiner Verrücktheiten und der Bedeutung seines Amtes gegenwärtig geeigneter, diesen Befund zu illustrieren, als Donald Trump. Der US-Präsident gibt einem erstaunten und zugleich entsetzten Publikum unter dem Titel »Narziss und Volksmund« ein Schmierenstück, das nicht zuletzt daraus besteht, die rassistischen, sexistischen und homophoben Ressentiments seiner treuesten Anhänger zu bestätigen und bestärken. Die Twitterbotschaft ersetzt die Pressemitteilung, und die Politik mit dem Smartphone wirkt so erratisch und unberechenbar, dass es schwerfallen mag, dahinter eine distinkte Kapitalstrategie zu erkennen. Dabei darf gleichwohl nie aus dem Blickfeld geraten, dass eine drastische Steuerentlastung für Vermögende und Unternehmen sowie eine ebenso drastische Erhöhung eines ohnehin schon gigantischen Rüstungsetats die entscheidenden politischen Taten seiner bisherigen Amtszeit waren – unter dem Gesichtspunkt der Kapitalherrschaft sind das ausgesprochen zweckrationale Maßnahmen, die indes den ganzen Irrationalismus dieser Gesellschaftsordnung schonungslos bloßlegen.
Das, was Trump auf 140 beziehungsweise seit kurzem auf epischen 280 Zeichen mitzuteilen hat, steht in der Regel mit der Wahrheit erkennbar auf Kriegsfuß, oder anders gesagt: »Wahr ist, was am meisten Klicks und Likes und Follower generiert. Wahr ist, was verkauft werden kann.« (Georg Seeßlen in konkret 11/2017). Die Fähigkeit, »alternative Wahrheiten« in Geld zu verwandeln, schmerzt die Medien, die ihre Monopolstellung zur Bestimmung dessen, was wahr ist, seit längerem eingebüßt haben, nämlich spätestens seit es den Wunderlingen mit den verschrobenen Ansichten möglich ist, sich etwa bei facebook mit ihresgleichen zur virtuellen Community zu erheben, die den Fernsehnachrichten und Zeitungsmeldungen schon lange nicht mehr glaubt. Der Schreihals wiederum, der mit dem »Lügenpresse«-Gebrüll seinen dumpfen Hass ausspeit, offenbart seinen autoritären Charakter und nicht selten faschistische Gesinnung. An Wahrheit ist auch er nicht interessiert.
Mitleid mit der »Journaille« verbietet sich jedoch. Deren besonderer Eifer, alles mit sinnentleerter Phrase zuzukleistern, führte noch immer – nun ja – die Lüge mit sich. Vom Krieg, der Menschen in ein Schlachthaus sperrt, heißt es in den Presseerzeugnissen oft genug, er werde um der Menschlichkeit willen geführt, von der »Sozialreform«, die etliche in die Armut stürzt, sie solle wieder in Lohn und Brot bringen. Und waren es nicht die Feuilletons der großen Gazetten, die postmodernen Denkern jahrzehntelang ein Forum boten, in dem diese triumphierend verkünden konnten, »Die Wahrheit ist tot, es lebe das Narrativ!« und die alle, die sich dieser Heilsbotschaft verweigerten, unter Totalitarismusverdacht stellten?
Die nachvollziehbare und wachsende Skepsis an den Hervorbringungen der großen Medienhäuser hat viele dazu gebracht, sich vermehrt Verbreitern alternativer Informationen zuzuwenden, die sich online sonder Zahl finden lassen und vereinzelt hohen Zuspruch erfahren. Von den allerwenigsten lässt sich indessen behaupten, sie stünden mit Wahrheit und Kritik, Aufklärung und Vernunft im Bunde. Da ist beispielsweise ein Mann, dessen Internetportal recht stark frequentiert wird und der von den Betreibern eines anderen Portals mit selbsterklärtem linkem Anspruch einen ausgerechnet nach Marx benannten »Kölner Karlspreis« für »seinen aufklärerischen, unabhängigen, facettenreichen, urdemokratischen Journalismus« erhalten hat. Was aber ist von der aufklärerischen Güte dieses Journalisten zu halten, wenn er in seinen Videosendungen etwa die Existenz von Chemtrails, also die angeblich absichtliche Ausbringung von Chemikalien aus gewöhnlichen Linienflugzeugen zu perfiden, jedenfalls der Bevölkerung unbekannten Zwecken insinuiert? Wohlgemerkt insinuiert, nicht behauptet, und niemals mittels überprüfbarer, hieb- und stichfester Rechercheergebnisse beweist. Denn das wäre schlicht nicht möglich.
Das Vorgehen zeigt ein erkennbares und wiederkehrendes Muster. Vermeintliche oder tatsächliche Merkwürdigkeiten – im gegebenen Beispiel sind das Aufnahmen, die abreißende Kondensstreifen am Himmel bzw. Ventile am Flugzeug zeigen, deren Funktion als unklar ausgewiesen wird – werden solcherart extrapoliert, dass der Eindruck entsteht, die offizielle Darstellung könne unmöglich stimmen. Die hat nämlich von vornherein falsch zu sein. Es ist das permanente Geraune: »Merkt ihr was? Da ist was faul. Die führen was im Schilde!« Begründete, am Ende gar wissenschaftlich überprüfbare Einwände kommen dabei nie zur Geltung oder verfallen als Teil der Verschwörung unbesehen der Ablehnung. So soll die Auseinandersetzung gewonnen sein, noch bevor sei begonnen wurde.
Die Reduktion auf die Cui-bono-Frage schränkt das Sichtfeld ein. Politik erscheint so immer bloß als das Resultat übler Machenschaften. An die Stelle der Strukturanalyse tritt die Schuldzuweisung. Wahrheit kann indes nie anders denn als Zusammenhang gefasst werden. Hier aber verkümmert sie zu einer ausschließlich politischen Angelegenheit, die einer erkannt haben will und mutig genug ist, sie auszusprechen. Gesellschaft wird nicht als Struktur verstanden, politische Bewegungen, Gruppen und Parteien mit bestimmten Interessen und Verhaltensweisen werden nicht aus ihrer jeweiligen Stellung in der Gesellschaft abgeleitet und erklärt.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2018
- ISBN (ePUB)
- 9783961703098
- ISBN (eBook)
- 9783961706099
- ISBN (MOBI)
- 9783961703098
- Dateigröße
- 1.8 MB
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2018 (Januar)
- Schlagworte
- Marxismus Marxistische Blätter Neue Impulse Verlag Irrationalismus