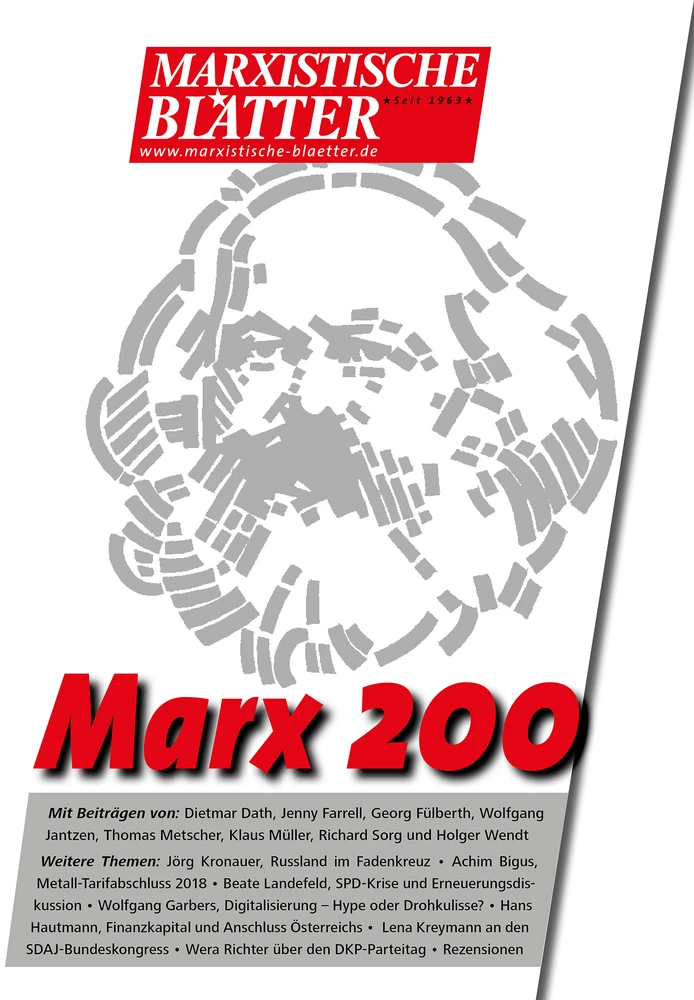Zusammenfassung
Weitere Themen: Jörg Kronauer, Russland im Fadenkreuz • Achim Bigus, Metall-Tarifabschluss 2018 • Beate Landefeld, SPD-Krise und Erneuerungsdiskussion • Wolfgang Garbers, Digitalisierung – Hype oder Drohkulisse? • Hans Hautmann, Finanzkapital und Anschluss Österreichs • Lena Kreymann an den SDAJ-Bundeskongress • Wera Richter über den DKP-Parteitag • Rezensionen
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
»Höchstwahrscheinlich …« (»highly likely«)
Lothar Geisler
Da werden Sergej Skripal, ein Ex-Doppelagent seiner Majestät aus Russland, und seine Tochter bewusstlos auf einer Parkbank in Salisbury aufgefunden. In jedem drittklassigen Thriller verkündet der ermittelnde Staatsanwalt: »Wir ermitteln in alle Richtungen.« Nicht so in London, der »Hauptstadt friedensgefährdener Lügen« (Willy Wimmer/CDU) wo die britische Staatslenkerin Theresa May frei von Fakten die Richtung ganz fix vorgibt: »Vergiftet mit ›Nowitschok‹!« und »Der Russe war’s!« Na ja, »Highly-likely« – »Höchstwahrscheinlich«, räumt sie ein.
Offene Fragen nach dem verwendeten Nervengift (›Nowitschok‹ oder nicht?), seiner Herkunft (Usbekistan, Russland, USA oder andere x-beliebige Giftküche?), der Nachweismethode (mit oder ohne Vergleichsprobe?), plausiblen Tatmotiven oder auch Motiven, Russland diesen Mordversuch anzuhängen, werden systematisch ausgeblendet. Außer auf Nachdenkseiten.de. Dort wurde u.a. auf brisante Fakten, Fragen, Hintergrund-Infos des ehemaligen, britischen Botschafters in Usbekistan, Craig Murray, hingewiesen. Z.B. auf die Zusammenarbeit von Sergej Skripal mit seinen beiden ehemaligen MI6-»Bärenführern«, Christopher Steele und Pablo Miller, deren obskure private Sicherheitsfirma Orbis Intelligence darauf spezialisiert ist, zahlungskräftigen Kunden antirussische Propaganda-Kampagnen zu basteln. Aus ihrer Giftküche stamme auch das für das Clinton-Lager erstellte, sensationelle Dossier über Trumps Beziehungen zu Russland, zu dem auch Sergej Skripal beigetragen hat. Highly likely.
US-, NATO-, EU-Spitze, die »Macht um Acht« (tagesschau) und die meisten anderen Massenmedien tröten wider besseres Wissen aus imperialistischer Kumpanei ins gleiche Horn wie Theresa May: »Der Russe war’s!« Also Sanktionen her, russische Diplomaten (Spione) raus, WM-Boykott … alles, das ganze Eskalationsinstrumentarium des Kalten Krieges wird reaktiviert. Deeskalierende Diplomatie, politische Gesprächskanäle und staatliche Beziehungen zu gegenseitigem Nutzen werden geschwächt. Die Dringlichkeit der Suche nach einem System gemeinsamer Sicherheit, Handels und Handelns durch Rüstungskontrolle und Abrüstung rutscht immer mehr aus dem Fokus.
Wer sich ein wenig mit der Geschichte auskennt, wie Kriege gemacht werden, denkt bei den Salisbury-Tales spontan an Colin Powells Schwindelkampagne über irakische Massenvernichtungswaffen (2002/03) oder die Kriegsvorwände von Sarajewo (1914), Gleiwitz (1939), Tonkin (1964) oder daran, wie dereinst Ronald Reagan’s »Komitee für Täuschungsoperationen« in den 1980er Jahren reihenweise »russische« U-Boote vor Schwedens Küste vortäuschte, um die Ängste in Europa zu nähren und Bedrohungsgefühle besonders bei den »kriegsunwilligen« Schweden zu fördern. (Siehe die jüngst erneut ausgestrahlte arte-Dokumentation aus dem Jahr 2015.)
Der Kalte Krieg gegen Russland wird wegen dieses aktuellen Salisbury-Zwischenfalls wohl (noch) nicht in einen heißen Russlandfeldzug der NATO münden, zumal die neuen APS-Kriegsgerätelager der USA im niederländischen Eygelshoven, im belgischen Zutendaal und im münsterländischen Dülmen erst ab 2020 voll bestückt und einsatzbereit sein sollen. Im Nahen und Mittleren Osten tobt allerdings bereits ein heißer, unkalkulierbarer Krieg, in dem Russland’s Beteiligung die Geopolitik des US-Imperialismus ganz besonders stört. Highly likely hat auch das mit dem Gift-Anschlag in Salisbury zu tun.
Russland im Fadenkreuz
Die NATO – vorne präsent und einsatzbereit[1]
Jörg Kronauer
Kern des gegen Russland gerichteten militärischen Dispositivs, das die NATO seit 2014 in Ost- und Südosteuropa errichtet hat, ist ihre sogenannte Enhanced Forward Presence (eFP) – vier in Estland, Lettland, Litauen und Polen stationierte multinationale Bataillone. Jedes von ihnen wird von einer schlagkräftigen NATO-Rahmennation geführt – im estnischen Tapa von Großbritannien, im lettischen Ādaži von Kanada, im litauischen Rukla von Deutschland und im polnischen Orzysz von den Vereinigten Staaten. Die insgesamt gut 4.500 Militärs werden mit ihrem schweren Gerät alle sechs Monate gegen ein neues Kontingent ausgetauscht; dabei handelt es sich um ein Zugeständnis an die NATO-Russland-Grundakte, die eine dauerhafte Stationierung von NATO-Truppen in den ost- und südosteuropäischen Mitgliedstaaten für nicht wirklich vorgesehen erklärt. Die eFP besteht entsprechend nicht aus fest stationierten, sondern aus rotierenden Kampftruppen, was zwar den Wortlaut der NATO-Russland-Grundakte wahrt, ihrem Geist aber zuwiderläuft. Die Bataillone, die die NATO auch Battlegroups nennt und die am 29. Juni 2017 bei einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister offiziell für einsatzfähig erklärt wurden, führen Kriegsübungen wie »Iron Wolf« sowie Ausbildungsmaßnahmen durch, wobei sie eng mit den jeweiligen einheimischen Streitkräften kooperieren. …
Für ihre gegen Russland gerichteten Aktivitäten in Osteuropa verfügt die NATO inzwischen über eine eigene militärische Führungsstruktur. Am 3. Juli 2017 ist im polnischen Elbląg rund 50 Kilometer südlich der Oblast Kaliningrad das neue Headquarters Multinational Division North-East (HQ MND-NE) offiziell eingeweiht worden. Mit rund 300 Soldaten aus 14 Staaten, darunter Deutschland, führt es die vier Bataillone der eFP. Seinerseits ist es dem Headquarters Multinational Corps North-East (HQ MNC-NE) im nordwestpolnischen Szczecin unterstellt. Dieses wiederum wurde schon am 18. September 1999, nur ein halbes Jahr nach Polens NATO-Beitritt, gegründet. Neben den drei Führungsnationen Deutschland, Polen und Dänemark sind inzwischen 22 weitere Staaten involviert. Teile der mehr als 400 Soldaten starken, abwechselnd von einem deutschen und einem polnischen Kommandeur geleiteten Einheit haben ihre Fähigkeiten dreimal (2007, 2010, 2014) in Afghanistan erprobt. Heute hat das HQ MNC-NE als einziges unter den NATO-Hauptquartieren eine fest definierte regionale Zuständigkeit: für Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Slowakei und Ungarn. Zwar ist es auf die Führung von Landstreitkräften spezialisiert, unterhält daneben aber auch ein Koordinierungszentrum für Luftoperationen (Air Operations Coordination Centre). Seit dem 14. Juni 2017 ist es offiziell als Hauptquartier auch für High Readiness Forces zertifiziert.
Die NATO-Speerspitze
Letzteres bezieht sich insbesondere darauf, dass das HQ MNC-NE in Szczecin nicht nur dem HQ MND-NE in Elbląg – und damit der eFP – übergeordnet ist, sondern auch die NATO-«Speerspitze« führt, sobald diese nach Osteuropa verlegt wird. Die »Speerspitze« bzw. Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), die rund 5.000 Soldaten umfasst, ist in der Lage, binnen 48 bis 72 Stunden an jedem beliebigen Ort zu intervenieren. Die Eingreiftruppe ist Teil der NATO Response Force (NRF), die alles in allem ungefähr 40.000 Soldaten zählt und die VJTF im Einsatzfall kurzfristig mit weiteren Einheiten unterstützen kann – nicht zuletzt mit Luft- und Seestreitkräften und vor allem auch mit Spezialkommandos. Um die Interventionsfähigkeit der VJTF sicherzustellen, führt das HQ MNC-NE in Szczeczin sechs sogenannte NATO Force Integration Units (NFIU) – »kleine multinationale Hauptquartiere«, wie es die Bundeswehr formuliert, die in Osteuropa »die Sicherheitslage beobachten« und im Einsatzfall »für die reibungslose Aufnahme der schnellen Einsatzkräfte vor Ort zuständig« sind. NFIUs sind – im Kommandobereich des HQ MNC-NE – in Tallinn (Estland), Riga (Lettland), Vilnius (Litauen), Bydgoszcz (Polen), Székesvehérvár (Ungarn) und Bratislava (Slowakei) eingerichtet worden. Sie sind jeweils mit ungefähr 40 Militärs besetzt; das Standortland und die NATO entsenden jeweils 20.
Eine parallele Struktur baut die NATO in Südosteuropa auf. Analog zu den multinationalen Hauptquartieren in Polen hat das Bündnis im Juni 2017 ein Headquarters Multinational Division South-East (MND-SE) in Bukarest für einsatzfähig erklärt. Das HQ MND-SE, dem ungefähr 280 Soldaten angehören, führt Einsätze der NATO »Speerspitze« in Südosteuropa; dazu sind ihm zwei NFIUs in Bukarest (Rumänien) und Sofia (Bulgarien) unterstellt. Parallel zur baltisch-polnischen eFP baut die NATO zudem eine multinationale Brigade in Craiova (Rumänien) auf. Die NATO-Aktivitäten in Südosteuropa werden – im Unterschied zu denjenigen im Nordosten – nicht vom Allied Joint Force Command im niederländischen Brunssum, sondern vom Allied Joint Force Command in Neapel betreut.
Vom Frontstaat zur Transitzone
Zusätzlich zur NATO forcieren die Vereinigten Staaten auf nationaler Ebene die militärische Formierung Ost- und Südosteuropas gegen Russland. Im Juni 2014 hat Washington die European Reassurance Initiative (ERI) gestartet, in deren Rahmen US-Truppen nach Ost- und Südosteuropa entsandt, gemeinsame Manöver mit den dortigen Streitkräften durchgeführt und die militärische Infrastruktur vor Ort ausgebaut werden. Stellte Washington im Haushaltsjahr 2015 zunächst 985 Millionen US-Dollar, für 2016 dann 789 Millionen US-Dollar bereit, so stieg der Betrag für 2017 rapide auf 3,4 Milliarden und für 2018 weiter auf 4,8 Milliarden US-Dollar. Hintergrund ist zum einen, dass die US-Streitkräfte seit Januar 2017 regelmäßig eine komplette Brigade mit rund 4.000 Soldaten und schwerem Gerät nach Ost- und Südosteuropa entsenden (Operation Atlantic Resolve, OAR); auch sie wird – wie die eFP-Bataillone – mit formaler Rücksicht auf die NATO-Russland-Grundakte alle neun Monate ausgetauscht. Dabei wird sie jeweils zunächst nach Polen transportiert, wo sie sich sammelt, um zu Ausbildungsmaßnahmen und Manövern weiter nach Estland, Lettland, Litauen, Rumänien und Bulgarien auszuschwärmen. Manche Kriegsübungen hält die Brigade auch auf deutschen Truppenübungsplätzen ab, etwa im bayrischen Grafenwöhr. Für die OAR hat die Bundesrepublik eine besondere Bedeutung: Teile des An- und Abtransports der jeweils per Schiff aus den USA nach Europa verlegten Brigade werden über norddeutsche Häfen abgewickelt und von der Bundeswehr unterstützt; in der Logistikkette spielen etwa das Anlanden der US-Transportschiffe in Bremerhaven und Hilfsaktivitäten der Bundeswehr-Logistikschule in Garlstedt zwischen Bremen und Bremerhaven eine bedeutende Rolle. Die Bundesrepublik sei vom »Frontstaat« des Kalten Kriegs zur »Transitzone« im neuen Kalten Krieg geworden, konstatierte Anfang 2017 aus Anlass der ersten Verlegung einer US-Brigade nach Ost- und Südosteuropa der stellvertretende Inspekteur der Bundeswehr-Streitkräftebasis, Generalleutnant Peter Bohrer.
Die zweite Ursache dafür, dass die US-Ausgaben für ERI 2017 und 2018 dramatisch in die Höhe schnellten, sind der Aufbau und die Bestückung mehrerer Lager mit sogenanntem Army Prepositioned Stock (APS) gewesen. Das kostspielige APS-Konzept sieht vor, US-Kriegsgerät – Panzer, Haubitzen, Militärtransporter und vieles mehr – weitgehend einsatzfähig in Europa zu deponieren, um im Ernstfall nur noch die zugehörigen Soldaten einfliegen zu müssen. Binnen kürzester Zeit könnten die Einheiten dann zum Einsatzort aufbrechen. Mittels APS werde – verdeckt – »eine amerikanische Armeedivision in Europa stationiert«, ließ sich der US-Botschafter bei der NATO, Douglas Lute, bereits im Februar 2016 zitieren. Dabei handle es sich um eine Einheit mit rund 15.000 bis 20.000 Soldaten. APS-Lager sind im niederländischen Eygelshoven unweit Aachen, im belgischen Zutendaal bei Genk, in Miesau nahe der Air Base Ramstein sowie in Dülmen bei Münster eingerichtet worden. Die Stationierung recht weit im Westen sichert für etwaige Einsätze in Ost- und Südosteuropa größere Flexibilität: Der Transport an dortige Kriegsschauplätze wäre jederzeit recht problemlos möglich, während eine Verlegung von Material zum Beispiel aus Rumänien ins Baltikum wegen der vergleichsweise schlecht ausgebauten östlichen Infrastruktur im Ernstfall viel schwieriger zu bewerkstelligen wäre.
Drei Wellen
Wie würden die NATO-Truppen im Ernstfall vorgehen? Komme es zu militärischen Auseinandersetzungen, dann müsse deren »erste Welle« von denjenigen Einheiten getragen werden, die kontinuierlich in den östlichen und südöstlichen NATO-Staaten präsent seien, heißt es in einer Analyse der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) – also »von den Kräften der eFP, den Armeen der regionalen Staaten und anderen Präsenzkräften«. Unter »anderen Präsenzkräften« wird man wohl vor allem die US-Einheiten zu verstehen haben, die im Rahmen der Operation Atlantic Resolve zwischen dem Baltikum und Rumänien pendeln. Die »zweite Welle« etwaiger Kämpfe werde – mit Hilfe der NFIUs – von der binnen 48 bis 72 Stunden einzufliegenden NATO-»Speerspitze« und in deren Kielwasser von der NRF geführt, erläutert die SWP. Für die »dritte Welle«, die danach beginne, gebe es allerdings noch »keine designierten Einheiten«; man werde nehmen müssen, was man aus den NATO-Mitgliedstaaten bekomme. Genau hier setzten aber die Pläne Berlins für die Zukunft der Bundeswehr an, erläutert die SWP. So sei vorgesehen, dass deutsche Einheiten Heeresteile anderer europäischer Staaten aufnähmen; tatsächlich sind bereits rund zwei Drittel der niederländischen Heeresverbände in Bundeswehr-Divisionen integriert, einige tschechische, rumänische und polnische Einheiten stehen vor diesem Schritt. Damit werde »die Grundlage für kampfstarke multinationale Divisionen um die Rahmennation Deutschland gelegt«, bilanziert die SWP. Dies geschehe auch »mit Blick auf mögliche Einsatz-Szenarien (etwa im Osten der Allianz, aber nicht nur) …, um so Folgekräfte verfügbar zu machen«. Das sei »neu und politisch wie militärisch sehr ambitioniert«. Dabei wäre »die Rolle Deutschlands in diesen Verbänden und Strukturen signifikant«.
Ganz so einfach, wie sie klingen, liegen die Dinge mit der »zweiten« und der »dritten Welle« aber möglicherweise nicht. Denn die NATO-»Speerspitze«, die NRF und die um einen Bundeswehrkern gruppierten multinationalen Divisionen müssten an etwaige Kriegsschauplätze im Osten oder im Südosten Europas erst eingeflogen werden. Das aber könnte sich deutlich schwieriger gestalten als gedacht – denn Russland hat, wie Militärstrategen konstatieren, eine »A2/AD«-Zone an seiner Westgrenze errichtet. »AD« steht für »area denial« – dafür, dass Operationen feindlicher Kräfte in einem bestimmten Gebiet schwer durchführbar, vielleicht sogar unmöglich gemacht werden: So erläutern es die drei Ex-NATO-Generäle Wesley Clark (USA), Egon Ramms (Deutschland) und Richard Shirreff (Großbritannien) sowie der mehrmalige estnische Außen- und Verteidigungsminister Jüri Luik in einem Papier, das sie im Mai 2016 veröffentlichten. »A2« wiederum steht für »anti-access«, also dafür, dass es Land-, See- und Luftstreitkräften sehr schwer gemacht wird, überhaupt erst in dieses Gebiet einzudringen. Die A2/AD-Zone, die Russland durch die Stationierung unter anderem von hochwirksamen S-300- und S-400-Luftabwehrsystemen, von Iskander-Raketen und anderem Gerät in seinem Westlichen Militärbezirk und der Exklave Kaliningrad, aber auch durch die Koordination seiner Abwehrsysteme mit der belarussischen Verteidigung errichtet hat, erstreckt sich den NATO-Generälen zufolge auf die baltischen Staaten sowie auf Teile Polens und Finnlands. Die Mobilität der russischen Abwehrsysteme hat zur Folge, dass sie nicht so einfach auszuschalten sind; hinzu kommt die Schlagkraft der russischen Luftwaffe und der Marine. Durch den gesamten russischen Abwehrkomplex würden »die meisten, wenn nicht sogar alle Flugzeuge«, die in den Luftraum über der östlichen Ostsee einzudringen suchten – etwa um Verstärkung zu bringen –, »in Gefahr gebracht«, bemerken Clark, Ramms, Shirreff und Luik.
Mit Drohnenschwärmen gegen Russland
Selbstverständlich arbeiten die NATO und ihre Streitkräfte an Optionen, die russische Luftabwehr bei Bedarf auszuschalten, um die Verlegung eigener Truppen ins Baltikum durchsetzen zu können. Einen Eindruck davon bietet ein Thesenpapier, das das Kommando Heer mit Sitz in Strausberg bei Berlin im September 2017 vorgelegt hat. Das Heereskommando verfolgt mit dem Papier durchaus eigene Zwecke. So soll das Dokument zum einen die Erstellung eines »Operationskonzepts für Landstreitkräfte« vorbereiten, das in Zukunft als militärisches Grundlagendokument dienen kann. Zum anderen soll es erklärtermaßen als »Anregung zur Diskussion« dienen; dabei zielt es ganz besonders auf den Deutschen Bundestag, der ja schließlich kostspielige Aufrüstungsprojekte genehmigen muss. Um bei den Abgeordneten Eindruck zu schinden, hat ein Autorenteam des Kommandos Heer für das Thesenpapier verschiedene Kriegsszenarien entworfen, denen man zumindest in Ansätzen entnehmen kann, wie sich die Militärs die Waffengänge der Zukunft vorstellen. Interessant ist dies nicht zuletzt, weil die Rahmenangaben recht deutlich machen, wo die Szenarien angesiedelt sind und was sie darstellen: Es handelt sich um Kämpfe gegen russische Truppen im Baltikum.
Was also tun, wenn Russland eine kaum zu durchdringende A2/AD-Zone im Baltikum errichtet hat? Es gelte ganz einfach, die geplante Truppenverlegung dorthin »durch den massiven Einsatz von Täusch-UAV zu tarnen«, heißt es in dem Thesenpapier aus dem Kommando Heer. UAV (Unmanned Aerial Vehicle) sind Drohnen; relativ billige Minidrohnen kann man elektronisch so konfigurieren, dass sie von feindlicher Luftabwehr als Hubschrauber wahrgenommen werden. Schickt man Truppentransporter mit großen Minidrohnenschwärmen auf den Weg, dann kann man »der gegnerischen Luftverteidigung eine Vielzahl von Einsatzverbänden vortäuschen«, heißt es weiter in dem Papier. Der Gegner wäre überlastet, weil ihm »mehr Ziele geboten werden«, als er »bekämpfen kann«; er verschösse seine kostbaren Abwehrwaffen auf nutzlose Minidrohnen, während die Truppentransporter der Bundeswehr sicher an den Einsatzort gelangten. »Parallel« müsse man die Operation freilich durch »Angriffe auf das Luftverteidigungsnetzwerk des Gegners in mehreren Dimensionen« unterstützen, erklärt das Autorenteam aus dem Heereskommando; dabei würden »Cyber-Angriffe, Angriffe aus der Luft, vom Boden und von See« mit einer »gezielte[n] Störung« durch elektronische Waffen und mit »Einsätze[n] von Spezialkräften gegen Führungseinrichtungen kombiniert«. Szenarien dieser Art listet das Thesenpapier für sehr unterschiedliche Operationen auf – nicht nur für die Verlegung von Truppen und für Defensivmaßnahmen, sondern auch für eigene Angriffe, etwa für Vorstöße mit gepanzerten Fahrzeugen. Der Sache nach handelt es sich dabei um etwaige Angriffe auf russisches Territorium.
[1] Auszug mit freundlicher Genehmigung des PapyRossa-Verlages aus: Jörg Kronauer, Meinst Du, die Russen wollen Krieg? Russland, der Westen und der zweite Kalte Krieg, Köln, März 2018.
Klare Warnung an Macron
Georg Polikeit
Das war eine klare Warnung an Frankreichs Staatschef Macron: am gewerkschaftlichen Aktionstag für die öffentlichen Dienste haben sich am 22. März mehrere hunderttausend Französinnen und Franzosen an rund 180 Kundgebungen und Demonstrationen im ganzen Land beteiligt. Mehr als 500.000 Teilnehmer nach Angaben des linken Gewerkschaftsbundes CGT, aber immerhin 323.000 auch laut dem französischen Innenministerium.
Der Protest richtete sich in erster Linie gegen die von der Regierung beabsichtigte Streichung von rund 120.000 Stellen in verschiedenen öffentlichen Diensten. Außerdem waren die kürzlich beschlossene Einführung eines »Karenztages« im Krankheitsfall, an dem es weder Lohnfortzahlung noch Krankengeld gibt, und das »Einfrieren« des Indexpunktes für die Höhe der Gehälter Stein des Anstoßes.
Die Beteiligten bekundeten, wie die CGT in einer Erklärung hervorhob, ihr Festhalten am Prinzip von öffentlichen Diensten gegen die Privatisierungsabsichten der Regierung. Sie wollen den Erhalt und den Ausbau der öffentlichen Dienste und dafür mehr Mittel und Personal, damit sie ihre Angebote nicht nur im Interesse der Beschäftigten, sondern auch der Nutzer entsprechend den heutigen Möglichkeiten verbessern können.
Eine Besonderheit des Aktionstages vom 22. März war es, dass erstmals wieder seit langer Zeit eine breite gewerkschaftliche Einheit zustande kam. Alle sieben relevanten Gewerkschaftsbünde (CGT, FO, FSU, CFE-CGC, CFTC, Solidaires et FA-FP) der öffentlichen Dienste hatten sich trotz ihrer unterschiedlichen Grundhaltungen, eher aktionsbereit oder eher auf sozialpartnerschaftliche Verhandlungen ausgerichtet, zu einer gemeinsamen Aktionsfront zusammengeschlossen.
In einem Leitartikel der kommunistischen Tageszeitung »L’Humanité« hieß es dazu am 23.3., dass der unbestreitbare Erfolg der gewerkschaftlichen Demonstrationen ein Zeichen der zunehmenden Besorgnis in der Bevölkerung gegenüber der neoliberalen Offensive von Staatschef Macron und »ein Indiz eines neuen Klimas im Land« sei. Die anfänglich abwartende Haltung in weiten Teilen der Bevölkerung gegenüber der Politik Macrons und die »Erstarrung« angesichts seines nun sicht- und spürbar werdenden rigorosen Vorgehens scheine sich zu verflüchtigen.
In den Demonstrationszügen waren die Westen, Fahnen und Transparente der unterschiedlichen Berufsgruppen, von den Staatsbediensteten und Angestellten der Territorialverwaltungen über das Justizpersonal und die Lehrer und Beschäftigten im Bildungswesen bis zum Personal der öffentlichen Krankenhäuser zu sehen. In Paris vereinigten sich am Nachmittag auf dem geschichtsträchtigen Platz der Bastille ein Demonstrationszug der verschiedenen öffentlichen Dienste mit rund 40.000 Teilnehmern, ausgehend vom Stadtviertel Bercy im 12. Arrondissement, mit einer gesonderten Demonstration von 25.000 Eisenbahnern aus dem ganzen Land, ausgehend vom entgegengesetzt liegenden Gare de l’Est (Ostbahnhof).
Für die Eisenbahner war dies der Auftakt zu dem von den vier stärksten Gewerkschaftsbünden (CGT, UNSA, SUD und CFDT) beschlossenen, für drei Monate vereinbarten »perlenartigen« oder »punktartigen Streik« gegen die von der Regierung geplante »Reform« des staatlichen Eisenbahnunternehmens SNCF. Dieser begann am 3. April und dauert im Rhythmus von zwei Tagen Streik und drei Tagen Pause bis Ende Juni. Im Demo-Zug der Eisenbahner zogen auch Abordnungen von Gewerkschaften aus den Nachbarländern mit, so aus Belgien, Spanien, Großbritannien, der Schweiz und Deutschland.
Außer Paris gab es die größten Kundgebungen mit oft mehreren zehntausend Beteiligten in Marseille, Toulouse, Lyon, Nantes, Rennes, Rouen, aber auch mit etwa 5.000 Teilnehmern in Straßburg. Unterstützt wurde die Aktion auch durch Abordnungen der Parteien der politischen Linken, meist unter Beteiligung ihrer zentralen Führungspersonen, so Pierre Laurent von der PCF, Jean-Luc Mélenchon von der Bewegung der »Insoumises« (»Unbeugsamen«), Olivier Besancenot von der »Neuen Antikapitalistischen Partei« (NPA), Benoît Hamon, Ex-Präsidentschaftskandidat der »Sozialisten«, mittlerweile aus der PS ausgetreten und Anführer der Vereinigung »Génération.s«, Vertretern der Grünen-Partei EELV und anderen Linksgruppen. Diese Parteien und Vereinigungen hatten schon Tage vor dem 22. März in einer gemeinsamen Erklärung ihre Solidarität mit dem Anliegen der Gewerkschaften und Demonstranten bekundet.
Das war die erste gemeinsame politische Äußerung der Linksparteien seit langem. Auch der kürzlich neugewählte Vorsitzende der »Sozialistischen Partei« (PS), Olivier Faure, bekundete seine Unterstützung, musste allerdings erleben, dass er wegen seiner duldsamen Haltung gegenüber dem neoliberalen Kurs des vorigen Staatspräsidenten Hollande von Demonstranten angegangen und mit Pfui-Rufen bedacht wurde.
Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes wollten auf einer Zusammenkunft am 23.3. über den Fortgang der Bewegung beraten. Die CGT hat den Vorschlag unterbreitet, am 19. April einen neuen gemeinsamen branchenübergreifenden landesweiten Aktionstag durchzuführen.
Es kennzeichnet die angebliche »Ausgewogenheit« der deutschen Medien, dass die meisten von ihnen den erfolgreichen Aktionstag der Gewerkschaften in Frankreich einfach mit Schweigen übergangen haben.
Metall-Tarifabschluss 2018: Arbeitszeit – wie weiter?
Achim Bigus
Der Tarifabschluss für die Metall- und Elektroindustrie 2018 ist sehr komplex. Der Verlauf dieser Tarifbewegung war deutlich kontroverser und härter als die letzten Metalltarifrunden. Die IG Metall musste zum ersten Mal das neue Arbeitskampfinstrument ganztägiger Warnstreiks einsetzen. Das Thema »Arbeitszeit« ist wieder auf der Tagesordnung und in der öffentlichen Diskussion. Wohin die Reise weiter geht, ist mit diesem Abschluss noch nicht ausgemacht.
Das Verhandlungsergebnis
Das Verhandlungsergebnis mit seinen verschiedenen Bestandteilen ist kompliziert und schwer durchschaubar. Das war schon in der Forderung der IG Metall-Tarifkommissionen angelegt: keine kollektive Verkürzung der Arbeitszeit für alle, sondern individuelle Rechtsansprüche auf »kurze Vollzeit« für jede/n mit einem »lebensphasenorientierten« Entgeltzuschuss für Eltern, Pflegende und Schichtarbeitende.[1]
Im Ergebnis findet sich jetzt statt des von den Unternehmern vehement abgelehnten Entgeltzuschusses für die angesprochenen Gruppen ein »Zeitzuschuss«. Darüber hinaus sind in den Tarifkompromiss auch Anliegen der Kapitalseite nach weiterer Flexibilisierung der Arbeitszeiten nach oben eingegangen.
Beim Lohn darf man sich wegen der langen Laufzeit nicht blenden lassen von der Zahl »4,3 Prozent«. Falsch wäre aber auch, diese Zahl mit »Westrick-Formel« oder Dreisatz auf 27 Monate Laufzeit umzurechnen. Denn: ab 2019 wird einmal jährlich das »Tarifliche Zusatzgeld« fällig von 27,5 Prozent eines Monatseinkommens plus weitere 400 Euro Festgeld (für 2019, in den Folgejahren 12,3% vom Eckentgelt). 27,5 Prozent eines Monatslohns entsprechen bei ca. 13,2 Monatsentgelten im Jahr (mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld) etwa 2 Prozent Lohnerhöhung pro Monat; 12,3 Prozent vom Eckentgelt entsprechen weiteren 0,93 Prozent für Beschäftigte im Eckentgelt (Lohngruppe für Tätigkeiten mit dreijähriger Berufsausbildung) – für die höheren Entgeltgruppen prozentual entsprechend weniger, für die unteren entsprechend mehr. Diese »Zusatzgelder« gehen dauerhaft und tarifdynamisch in die zukünftigen Jahreseinkommen ein. In der Summe liegt der Lohnabschluss damit etwa auf gleichem Niveau wie die Metall-Abschlüsse der letzten Jahre: Keine Umverteilung von oben nach unten, aber deutlich mehr als Inflationsausgleich.
Bei der Arbeitszeit erreichte die IG Metall den geforderten Rechtsanspruch auf »kurze Vollzeit« mit Rückkehrrecht für jeden, aber nicht für alle Beschäftigten, sondern begrenzt auf maximal 10 Prozent der Belegschaften. Für Kindererziehung, Pflege und bei Schichtarbeit gibt es ab 1. Januar 2019 Anspruch auf acht Tage »tarifliche Freistellungszeit«. Sechs davon zahlt der Beschäftigte durch Umwandlung des »Tariflichen Zusatzgeldes« von 27,5 Prozent eines Monatslohns (»Wahloption« Geld oder Freizeit), zwei zahlt der Unternehmer als »Freizeitzuschuss« statt des geforderten Entgeltzuschusses.
Für die 400 Euro/12,3% vom Eckentgelt konnte Gesamtmetall eine »dauerhafte Differenzierung« durchsetzen: ein Unternehmer kann diese aufgrund seiner wirtschaftlichen Situation verschieben, kürzen oder gar nicht zahlen. Dafür braucht er allerdings die Zustimmung der Tarifparteien, also auch der IG-Metall-Mitglieder des betroffenen Betriebes. Die Zustimmung des (in der Regel leichter erpressbaren) Betriebsrates reicht nicht.
Zur Kompensation des durch »kurze Vollzeit« und »Wahloption« entfallenden Arbeitsvolumens hat die Kapitalseite eine Aufweichung der bisher geltende(n) maximalen Quote(n) für längere Arbeitszeiten bis zu 40 Stunden durchgesetzt. Dazu Gesamtmetall-Chef Rainer Dulger: »Mit diesem Modell haben wir genau die Flexibilisierung nach unten und nach oben vereinbaren können, die wir angestrebt haben«. Mit solchen Aussagen wollen die Unternehmer den Eindruck vermitteln, sie könnten jetzt einseitig die Arbeitszeit einzelner Beschäftigter verlängern. Doch auch in Zukunft steht, wie bisher, in den Manteltarifverträgen: »Soll für einzelne Arbeitnehmer die individuelle (…) Arbeitszeit auf bis zu 40 Stunden verlängert werden, bedarf dies der Zustimmung des Arbeitnehmers«.
Dabei ist natürlich klar, dass die einzelnen Arbeitenden mit ihren Chefs nicht »auf Augenhöhe« verhandeln. Es bleibt Aufgabe der Betriebsräte, dafür zu sorgen, dass diese Freiwilligkeit nicht nur auf dem Papier steht. Deren Mitbestimmung bei der Einhaltung der maximalen »Quoten« für Verträge mit längerer Arbeitszeit wurde im Tarifabschluss ebenfalls gestärkt. Die reale Umsetzung vor Ort wird also sehr von der Stärke der Beschäftigten und ihrer Betriebsräte und Vertrauensleute im jeweiligen Betrieb abhängen. Diese weitere Individualisierung und Verbetrieblichung ist die größte »Kröte« im Abschluss.
Arbeitszeitfragen sind Machtfragen
Für diesen Abschluss (mitsamt »Kröten«) mussten eine Million Metallerinnen und Metaller in Warnstreiks und noch einmal eine halbe Million in Tagesstreiks den Unternehmern zeigen, wer jeden Tag – und oft auch in der Nacht – die Werte schafft, auf denen ihr Profit beruht. Gezwungen wurden sie dazu durch die Reaktion der Unternehmer und ihrer Verbände auf die Forderungen der IG Metall.
Diese wiesen die Arbeitszeit-Forderungen als »fast unüberbrückbare Hürde« scharf zurück[2] und starteten schon in die erste Verhandlungsrunde mit massiven Gegenforderungen.[3] Den geforderten Entgeltzuschuss für Erziehende, Pflegende und Schichtarbeitende bezeichneten sie als »rechtswidrig« und reichten – im Vorfeld der Tagesstreiks – entsprechende Klagen ein, ohne Erfolg. Garniert wurde dieses Vorgehen mit markigen Sprüchen – manche davon sind wahre Perlen:
»Was habe ich mit den familiären Zuständen der Beschäftigten zu tun?« – ungeschminkt machte Dr. Volker Schmidt (Hauptgeschäftsführer NiedersachsenMetall) hier klar, dass Verkauf und Kauf der Arbeitskraft für die Beteiligten sehr verschiedene Zwecke verfolgen: geht es dem Verkäufer um die Existenz (mitsamt der »familiären Zustände«), so geht es den Dr. Schmidts um die Quelle des Profits und sonst gar nichts …
»Mehr Geld fürs Nichtstun wird es mit uns nicht geben« – so kommentierte Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger die Forderung nach einem Entgeltzuschuss bei Kindererziehung oder Pflege. Bei diesen Tätigkeiten handelt es sich also aus Unternehmersicht um »Nichtstun« – persönlich wäre ihm zu wünschen, nie auf Pflegende angewiesen zu sein, die das auch so sehen …
»Es geht nicht, dass der Arbeitnehmer allein entscheidet, wann er wie viel arbeiten will« – in diesem Satz von Unternehmerpräsident Ingo Kramer erkennt ein Kommentator[4] »ein vordemokratisches Denkmuster«, welches ins 19. Jahrhundert passe. Als sein Bruder im Geiste kritisiert Südwestmetall-Chef Stefan Wolf »Forderungen, die keine Rücksicht auf die betriebliche Organisation nehmen: Es ist aber immer noch die Hoheit des Unternehmers, diese Organisation aufrecht zu erhalten.«
Man sieht: wenn es um Arbeitszeiten geht, sehen die Herren »Sozialpartner« rot. Dazu noch einmal der Kommentar im »Kölner Stadt-Anzeiger«: »Beim Thema Arbeitszeit verstehen Arbeitgeber keinen Spaß. Die Metall-Unternehmer schon gar nicht. Ökonomisch haben sie zwar längst verkraftet, dass ihnen die IG Metall vor Jahrzehnten die 35-Stunden-Woche abgetrotzt hat. Aber mental haben sie hier noch immer eine nicht heilen wollende, schmerzhafte Wunde. Mediziner nennen dies Phantomschmerz.«
Ein Blick in die Geschichte der Regelung und Begrenzung von Arbeitszeiten zeigt weitere, tiefer liegende Gründe für die Verhärtung der Fronten: bei der Arbeitszeit geht es nicht »nur« um Verteilungsfragen wie beim Einkommen, sondern auch um Verfügungsgewalt und Macht – das illustrieren die Herren Kramer und Wolf.
Außerdem stehen sich bei diesem Thema zwei unvereinbare Grundpositionen gegenüber, seitdem in der kapitalistischen Produktionsweise die menschliche Arbeitskraft zur Ware geworden ist, welche aber Besonderheiten gegenüber anderen Waren aufweist. Hören wir dazu Marx: »Der Kapitalist behauptet sein Recht als Käufer, wenn er den Arbeitstag so lang als möglich (…) zu machen sucht. Andrerseits schließt die spezifische Natur der verkauften Ware eine Schranke ihres Konsums durch den Käufer ein, und der Arbeiter behauptet sein Recht als Verkäufer, wenn er den Arbeitstag auf eine bestimmte Normalgröße beschränken will.«[5]
Marx folgert: »Es findet hier also eine Antinomie« (ein Widerstreit von Gesetzen) »statt, Recht wider Recht, beide gleichmäßig durch das Gesetz des Warenaustausches besiegelt. Zwischen gleichen Rechten entscheidet die Gewalt. (…) Die Schöpfung eines Normalarbeitstages ist daher das Produkt eines langwierigen, mehr oder minder versteckten Bürgerkrieges zwischen der Kapitalistenklasse und der Arbeiterklasse.«[6]
Besonders in den Tagesstreiks als Schlachten dieses »Bürgerkriegs« haben die Beteiligten massenhaft ihre eigene Kraft erfahren: »Ohne uns läuft nichts!« Für diese Erfahrung muss man Dulger und Co. eigentlich danken …
Verkürzung oder Individualisierung der Arbeitszeit?
IG Metall-Verhandlungsführer Roman Zitzelsberger feiert den Abschluss als »mehr Selbstbestimmung bei der Arbeitszeit für die Beschäftigten«. In der Tat: hier wurde erstmals eine Flexibilisierung der Arbeitszeit vereinbart, welche sich an den Bedürfnissen der Arbeitenden orientiert und nicht an denen der Kapitalverwertung. Aber: »Es geht um ein Arbeitszeitverkürzungsprojekt… und nicht um ein Individualisierungsprojekt«, so Robert Sadowsky, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Gelsenkirchen, auf der Arbeitszeitkonferenz der DKP im November 2017.[7] Das Tarifergebnis enthält von beidem etwas.
Wohin rollt der Zug? Bleibt es bei der Aussage des IG Metall-Vorsitzenden Jörg Hofmann: »Es geht schon lange nicht mehr um die weitere kollektive wöchentliche Arbeitszeitverkürzung. Stattdessen wollen wir den unterschiedlichen Lebenslagen der Menschen gerecht werden …«?[8] Oder formieren sich in den Gewerkschaften wieder stärkere Kräfte, welche angesichts fortbestehender Massenarbeitslosigkeit und Prekarität sowie anstehender Rationalisierungsschübe (»Industrie 4.0«) auf kollektive Arbeitszeitverkürzungen setzen? Dafür müssten sich allerdings stärker als bisher politische Kerne in den Betrieben entwickeln, welche nicht nur einen betrieblichen, sondern einen gesellschaftlichen Blick auf Arbeitszeiten und andere Fragen haben.
In zwei Konflikten der nächsten Zeit werden weitere Weichen gestellt. Zum einen wurde die Angleichung der Arbeitszeiten in der Metallindustrie Ost an den Westen in dieser Runde noch nicht gelöst – im Osten laut Beschäftigtenbefragung für 91 Prozent »wichtig« oder »eher wichtig«, im Westen nur für 41 Prozent. Dafür gilt es, im Osten die betriebliche Durchsetzungskraft der IG Metall und im Westen die Solidarität zu stärken. Zum anderen »brauchen wir eine gesetzliche Flankierung unserer Arbeitszeitpolitik«.[9] Darum ist es nötig, den Angriffen aus Kapital und Kabinett auf das Arbeitszeitgesetz mit eigenen Forderungen entgegenzutreten.[10]
[1] Zu den Forderungen im Detail vgl. meinen Artikel in: Marxistische Blätter 1_2018, S. 13.
[2] Nordmetall-Präsident Thomas Lambusch, WESER-KURIER 4.1.2018.
[3] Die Gegenforderungen im Detail ebenfalls in: Marxistische Blätter 1_2018, S. 14.
[4] »Kölner Stadt-Anzeiger«, 3.1.2018.
[5] Karl Marx, Das Kapital, Bd. I., MEW 23, S. 249.
[6] Ebenda, S. 249, S. 316. Zum Thema lohnt sich: Das Kapital, Band 1, Achtes Kapitel, Der Arbeitstag, 1. Die Grenzen des Arbeitstags, MEW 23, S. 245–249, http://www.mlwerke.de/me/me23/me23_245.htm#Kap_8_1; sowie 7. Der Kampf um den Normalarbeitstag. Rückwirkung der englischen Fabrikgesetzgebung auf andre Länder, MEW 23, S. 315–320, http://www.mlwerke.de/me/me23/me23_245.htm#Kap_8_7.
[7] UZ-Doku. »30 Stunden sind genug«, S. 27.
[8] Neue Osnabrücker Zeitung, 4.11.2016.
[9] Robert Sadowsky, IG Metall Gelsenkirchen, UZ-Dokumentation »30 Stunden sind genug«, S. 25.
[10] Vgl. dazu Robert Sadowsky, »Trumpfkarte im Standortpoker«, UZ-Dokumentation »30 Stunden sind genug«, S. 21–27; Isa Paape, »Eine für alle – Die 35-Stunden-Woche«, »Z.« Nr. 113, März 2018, S. 14–19.
SPD-Krise und Erneuerungsdiskussion
Beate Landefeld
Mit einem Drittel gegen zwei Drittel der Beteiligten votierten beim SPD-Mitgliederentscheid am Ende weniger als erhofft gegen eine weitere Große Koalition. Angesichts der Stimmung unter den Aktiven, in den Ortsvereinen hatten viele ein knapperes Ergebnis erwartet. Immerhin waren bis zum März 2018 Zehntausende ehemalige Mitglieder und Anhänger dem Ruf der GroKo-Gegner »Tritt ein, sag nein!« gefolgt. Doch sie stellen nur einen kleinen Bruchteil derer, die die SPD in den vergangenen Jahrzehnten verließen. Nach 1945 hatte die SPD ihren Höchststand an Mitgliedern und Wählern am Ende der 1960er und in der ersten Hälfte der 1970er Jahre. Es war die Zeit der APO, der starken außerparlamentarischen Opposition gegen die Notstandsgesetze und den Vietnamkrieg der USA, für die Demokratisierung des Bildungswesens und eine Wende vom Kalten Krieg zur Entspannung. Die APO schuf die Stimmung im Volk, in der Willi Brandts Ruf »Wir wollen mehr Demokratie wagen« Resonanz fand. 1968 bis 1976 wuchs die SPD um 40 Prozent auf 1.022.191 Mitglieder.
Mit Helmut Schmidt begann der Abwärtstrend. Ein Schmidt-Spruch war: »Die Profite von heute sind die Investitionen von morgen und die Arbeitsplätze von übermorgen.« Er leitete mit Sparpolitik und dem Rollback von Reformen einen sozialreaktionären Ausweg aus der Krise 1974/75 ein, den die herrschenden Klassen wollten und der mit Kohls »geistig-moralischer Wende« nach rechts und mit Schröders Agenda 2010 sukzessive in den neoliberalen Umbau überging. Zudem fiel Ende der 1980er Jahre die Systemkonkurrenz weg. Veränderungen in der Klassenstruktur verschoben ebenfalls die Kräfteverhältnisse zuungunsten der Lohnabhängigen. Die in den »30 goldenen Jahren« nach 1945 erkämpfte soziale Sicherheit wurde durch mehr Unsicherheit, Prekarisierung und wachsende Armut abgelöst. Die Mitgliederzahl der SPD stabilisierte sich 1989 mit der Einverleibung der DDR zunächst noch mal leicht bei 921.430. Danach sank sie im Schnitt um 20.000 pro Jahr, im Agenda-Jahr 2003 um 43.000. Ende 2016 lag sie bei 432.704, um bis März 2018 leicht auf 463.722 zu steigen.[1]
Der leichte Anstieg zu Beginn des Wahlkampfs von Martin Schulz bestärkte jene in der SPD, die das Abschmelzen der Partei auf ein Niveau, wie es die Schwesterparteien in Griechenland, den Niederlanden und Frankreich erreicht haben, durch eine sozialere, stärker linksorientierte Politik verhindern wollen. Dass das möglich ist, zeigt Jeremy Corbyn in Großbritannien. In Deutschland wurde der kurze Frühling von Martin Schulz durch Annegret Kramp-Karrenbauers Sieg im Saarland jäh beendet. In der SPD-Führung hielten einige das »Soziale« ohnehin für das falsche Wahlkampfthema. Aus Sicht von Olaf Scholz muss die SPD durch »Wirtschaftskompetenz« punkten. Für heutige SPD-Führer bedeutet das die vorauseilende Orientierung an den Vorgaben des Großkapitals. So macht es ja auch die CDU/CSU, die Hauptpartei des deutschen Monopolkapitals, die bei Umfragen seit Jahrzehnten im Bereich »Wirtschaftskompetenz« die besten Noten erhält. Die Verbände des Kapitals haben allerdings andere Sorgen als die Gewährung von »Sozialgeschenken« zwecks Rettung der SPD. Für sie ist Schröders Agenda 2010 eine einzige »Erfolgsgeschichte« und hätte es längst eine Agenda 2020 und eine Agenda 2030 geben sollen. Sie wollen Steuersenkungen und neue TTIP-Gespräche als Antwort auf Trump, Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung statt höhere Sozialabgaben. Den Koalitionsvertrag kritisieren sie von rechts. Auf dem Parteitag der CDU gehörte Multimillionär Werner Bahlsen, Präsident des CDU-Wirtschaftsrats, zu den 27 Gegenstimmen gegen den Koalitionsvertrag.[2]
In Teilen der SPD kam nach dem Mitgliedervotum Verzagtheit auf. Auf Facebook gab es Stimmen wie diese: »In der dritten Auflage einer GroKo unter Merkel und mit diesem Führungspersonal ist eine Erneuerung der SPD ausgeschlossen. Was nun folgt, ist für mich unausweichlich: Parteiaustritt nach 36 Jahren Mitgliedschaft.« Das blieben aber Einzelstimmen. Trotz Enttäuschung wollen gerade Jüngere und Neueingetretene nicht gleich wieder das Handtuch werfen. Viele traten ein, um der Rechtsentwicklung und dem Aufstieg der AfD etwas entgegen zu setzen. Sie halten die SPD für nötig, jedoch mit einer anderen Politik. Das Bewusstsein, der Kurs der eigenen Parteiführung, vor allem seit Schröders Agenda, sei für den Aufstieg der Rechten mitverantwortlich, ist vorhanden, vor allem bei Aktiven, die das am Infotisch, in der Gewerkschaft und anderswo zu hören bekommen. War früher in der SPD von »Erneuerung« die Rede, blieb es meist beim schönen Wortgeklingel. Diesmal macht der Rechtsruck in der Gesellschaft die Erneuerung aus Sicht vieler zur Überlebensfrage. Daraus resultiert eine gewisse Entschlossenheit in den Formen ihres Auftretens.
Erneuerung in welche Richtung?
Doch was ist Erneuerung? Ein »schlichter Neuaufguss« werde nicht genügen, gab sogar der Bundespräsident der frisch gewählten Regierung mit auf den Weg. Vor der Wahl sprach Merkel von einem Deutschland, »in dem wir auch künftig gut und gerne leben wollen«. Nun sind plötzlich alle gegen ein »Weiter so«: Lindners FDP, die Junge Union, Jens Spahn, die Wirtschaft. Lindner-Freund Spahn profiliert sich als Sprachrohr jener aus dem Wirtschaftsflügel, die die neoliberale Modernisierung verschärfen wollen: mehr Flexibilität, Mobilität, Privatisierungen, Abgabensenkungen, keine »sozialen Wohltaten«, kein »Ausruhen« auf der momentan florierenden Wirtschaft, größere Anstrengungen im härter werdenden globalen Konkurrenzkampf, kein »Aufweichen des Reformdrucks« in der EU. Am Tag der Wahl der Kanzlerin kündigte Junge-Union-Chef Paul Ziemiak abends bei Maischberger »ein klares Stoppsignal der Union« an, falls die neue Regierung mit Frankreichs Macron eine »gemeinsame Schuldenübernahme« vereinbare. Einigen in der CDU/CSU ist Merkel »zu sozialdemokratisch«.
In die entgegengesetzte Richtung gehen die Erneuerungswünsche der GroKo-Gegner der SPD. Sie wollen eine linkere Politik: mehr soziale Gerechtigkeit, spürbare Umverteilung von Oben nach Unten, die Rückkehr zu einer »echten Sozialdemokratie«, wie sie unter Willi Brandt gewesen sei. Sie vermissen an der heutigen SPD Visionen oder wenigstens die Umrisse eines Entwurfs zur Lösung der »großen Fragen unserer Zeit«. »Spiegelstriche« im Koalitionsvertrag reichen ihnen nicht als Ausweis für sozialdemokratische Politik. Nur wenn die SPD eine klare linke Alternative zur Union verkörpere, könne sie wieder hegemonial werden. In diese Richtung drängen verschiedene Gruppen von GroKo-Gegnern, wie das Forum Demokratische Linke 21 um die baden-württembergische Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis, die 500 Unterzeichner der »Gemeinsamen Erklärung« von Abgeordneten, Kommunalpolitikern, Gewerkschaftern und Mitgliedern aus Nordrhein-Westfalen, die JuSos, die die No-GroKo-Kampagne konsequent antrieben und durchhielten. Sie alle konzentrieren sich auf soziale Fragen. Die Friedensfrage spielt bisher, wenn überhaupt, nur am Rande eine Rolle. Soweit sie sich zur Europapolitik äußern, wollen sie ein »demokratisches und soziales Europa«, keine Austeritätspolitik und einen »Neustart der EU«.[3]
Nach dem Mitgliedervotum riefen der direkt gewählte Dortmunder SPD-Bundestagsabgeordnete Marco Bülow und 30 Prominente aus SPD, sozialen Bewegungen, Initiativen und Kleinparteien (Piraten, Demokratie in Bewegung) zur Gründung einer außerparlamentarischen »Progressiven Sozialen Plattform« auf. Unter den Erstunterzeichnern sind Herta Däubler-Gmelin, Michael Müller (Naturfreunde), der Ökonom Heiner Flassbeck, Susanne Neumann, Ferda Ataman, Raul Krauthausen und Steve Hudson (deutsche Sektion der Labour-Party). Ziel ist zum einen, im außerparlamentarischen Raum Themen von links zu setzen und die von rechts gesetzten Themen zurückzudrängen. Zum anderen soll aus der Gesellschaft heraus Druck für die Erneuerung der SPD geschaffen werden.[4] Bülow lässt offen, ob aus der Plattform irgendwann einmal eine Wahlbewegung werden könnte. Im Vergleich zur von Sarah Wagenknecht angedachten »linken Sammlungsbewegung«, die nie aus den Puschen kam, muss ihm attestiert werden, dass er schneller war. Loslegen wollen die 30 Unterzeichner aber erst, wenn sich ihnen 5000 angeschlossen haben.
Eine andere Initiative trat nach der Regierungsbildung im Bundestag in Erscheinung: Zwölf junge Abgeordnete, laut Spiegel-Online großenteils direkt Gewählte, traten mit einer Erklärung »Die SPD – linke Volkspartei im 21. Jahrhundert« in Erscheinung, in der sie die Fixierung des Finanzministers Olaf Scholz auf die schwarze Null ablehnen: »Die schwarze Null ist kein finanzpolitisches Programm und kein eigenständiges Ziel. Politische Herausforderungen brauchen politische Antworten. Die notwendige Antwort auf die zu geringe Investitionstätigkeit und die zunehmende soziale Spaltung sind höhere Investitionen in Bildung, Wohnungsbau, Verkehrs- und digitale Infrastruktur sowie eine Veränderung der Einnahmenseite des Bundes. Hohe Einkommen und große Vermögen müssen endlich wieder einen angemessenen Anteil an der Finanzierung gesellschaftlicher Zukunftsaufgaben tragen.«[5] Die zwölf jungen Abgeordneten waren nicht alle gegen die GroKo. Ihre Forderung, die SPD müsse mit aktiver staatlicher Wirtschaftspolitik gemeinsam mit Gewerkschaften, Sozialverbänden und Unternehmensverbänden »die Wirtschaft in Deutschland und Europa als Garant für Fortschritt und Wohlstand ausgestalten« verrät eine gewisse Realitätsferne.
Idealistisches Staatsverständnis
Illusionen über die Machtverhältnisse in der kapitalistischen Bundesrepublik (wie auch in der EU) und ein idealistisches Staatsverständnis, welches den Staat als Vollzugsorgan des Mehrheitswillens und des Ausgleichs letztlich harmonisierbarer Interessen sieht, kennzeichnen alle derzeit in der SPD kursierenden Erneuerungsvorstellungen. Zwar wollen einige die SPD wieder als »Arbeitnehmerpartei« sehen, aber wohl nicht so weit gehen, Fragen nach der Klassenherrschaft in unserem Lande zu thematisieren. Marco Bülow berichtet von seiner Erfahrung, dass wichtige Gesetze letztlich nicht von den Bundestagsabgeordneten, sondern von der Exekutive gemacht und im Bundestag nur abgenickt werden. Zwecks Kontrolle, wer bei der Exekutive ein- und ausgeht, fordert er, bisher vergeblich, ein Lobbyregister, wie es in anderen Ländern schon existiert.[6] Doch es sind nicht nur Lobbyisten, die das Regierungshandeln inspirieren. Vielmehr garantiert ein Dickicht aus formellen, informellen, personellen, kulturellen Verflechtungen von Staat, Parteien, Unternehmerverbänden, Thinktanks, Medien, Clubs und Stiftungen dass der Diskurs der Monopolbourgeoisie und der Finanzoligarchie, von deren Entscheidungen die Wirtschaft abhängt, auch die politische Willensbildung im Land bestimmt, während man Organisationen der Lohnabhängigen, Mittelschichten und Verbraucher allenfalls anhört, um sie möglichst konfliktarm in die Politik im Konzerninteresse einbinden zu können.[7]
Illusionen zeigen sich auch in Bezug auf die EU. Hier wird hartnäckig ignoriert, dass die neoliberale Politik in EU und Eurozone in deren Vertragsgrundlagen wurzelt, vor allem den Maastricht-Verträgen, die Bedingung für die Zustimmung der deutschen Bourgeoisie zum Euro waren. Permanente Exportüberschüsse, die, wie die zwölf jungen Abgeordneten feststellen, in Europa zu »wirtschaftlichen Verwerfungen« führten, gehören seit 1951 zum Geschäftsmodell der deutschen Bourgeoisie. Sie machten die Nachbarländer zu Schuldnern und Deutschland zum Gläubigerland Europas. Die EU-Politik der Berliner Regierung, egal ob Frau Merkel sie mit einem Finanzminister Steinbrück, Schäuble oder Scholz exekutiert, besteht wesentlich aus der Entfaltung von Druck für die Einhaltung des »Stabilitätspakts«. Hier eine Wende zu erzwingen, erfordert eine Veränderung der Kräfteverhältnisse in unserem Land, die nur im härtesten Klassenkampf von unten erreichbar ist. Diese unerledigte »Hausaufgabe« verschwindet nicht durch die Vision eines solidarischen Europa. Solange sie unerledigt bleibt, existiert real kein solidarisches Europa, sondern die imperialistische EU unter deutscher Dominanz, in der sich die Spaltungen und Verwerfungen vertiefen.
Bei allen Widersprüchen macht die Tatsache, dass es in der SPD wieder eine linke Opposition gibt, zuallererst Hoffnung. Sie zeigt, dass die Klassenwidersprüche in unserem Land, die soziale Polarisierung, die Rechtsentwicklung nicht unbeantwortet bleiben. Sie stoßen auf Gegenwehr, die auch um etablierte und systemintegrierte Parteien keinen Bogen macht. Sie zeigt, dass die Ressourcen der linken Kräfte nicht ausgeschöpft, sondern erweiterbar sind. Eine aktivere SPD-Linke kann zur Stärkung außerparlamentarischer Bewegungen, zur Zurückdrängung der Rechten, zur Sammlung gesellschaftlicher Kräfte beitragen, die mit der Zeit in der Lage sein werden, eine Wende zu Frieden und Abrüstung, zu sozialem und demokratischem Fortschritt zu erkämpfen. Gewiss wird die SPD-Führung nicht untätig zusehen, sondern versuchen, die von der linken SPD-Opposition ausgehenden Impulse zu neutralisieren oder verpuffen zu lassen. Viele der heute rechten SPD-Führer(innen) waren früher auch einmal links. Die Wahrscheinlichkeit von Rückbildungen im Sinne einer Systemintegration sinkt aber im Maße, in dem auch die Linken außerhalb der SPD, die Partei Die Linke und vor allem die marxistische DKP an Stärke und Anziehungskraft gewinnen.
[1] Zahlen bis 1990 nach: Bundeszentrale für politische Bildung; 1990 bis 2017 nach: statista.com.
[2] »CDU-Parteitag segnet Koalitionsvertrag ab«, in: Wolfsburger Blatt vom 26.2.2018.
[3] Vgl.: »Jetzt SPD erneuern!« auf www.forum-dl21.de; Jan Dieren, Matthias Glomb und Jessica Rosenthal: Where is my Mind? Zur Frage, ob der Koalitionsvertrag Zukunftsvorstellungen bietet – und warum er es nicht tut, in: spw 1–2018, S. 5–7; »Eine neue Zeit braucht eine neue Politik – Gemeinsame Erklärung« auf http://www.nogroko.nrw; »Wir müssen den exorbitant Reichen etwas wegnehmen«, Interview mit Kevin Kühnert in Zeit online 18.3.2018.
[6] Marco Bülow: Idee zur Progressiven Sozialen Plattform – Auftritt bei WIESO in HH auf YouTube.
[7] Vgl. dazu: Ekkehard Lieberam, Parlamentarische Demokratie und Klassenherrschaft, in: Marxistische Blätter 2-2018, S. 24-35.
Eine arbeitende Partei
Zum 22. Parteitag der DKP
Wera Richter
Auf ihrem 22. Parteitag Anfang März in Frankfurt/Main zeigte sich die DKP als aktive und an sich arbeitende Partei. Es war spürbar, dass die Partei die unproduktiven internen Auseinandersetzungen überwinden und sich wieder ihrem Kerngeschäft, Partei der Arbeiterklasse zu sein, zuwenden will. Im Mittelpunkt stand die nötige Stärkung der DKP und damit auch ein Spannungsfeld: Auf der einen Seite zeichnete der Parteitag ein nüchternes Bild der DKP mit all ihren Problemen, das Bild einer Partei, die 50 Jahre nach ihrer Gründung um ihre Existenz kämpfen muss. Auf der anderen Seite fasste er mutige Beschlüsse zum Beispiel das 20. UZ-Pressefest im September in Dortmund durchzuführen und bis dahin 30 000 Unterschriften für die Kampagne »abrüsten statt aufrüsten« zu sammeln.
Patrik Köbele, der mit deutlicher Mehrheit als Vorsitzender der DKP bestätigt wurde, hatte im Vorfeld gemahnt, dass nach drei Parteitagen, die sehr theoretisch angelegt waren, bei diesem sehr viel stärker auf die Einheit von Theorie und Praxis geachtet werden müsse. Der dann vorgelegte 20seitige Leitantrag »Die Offensive des Monopolkapitals stoppen. Gegenkräfte formieren. Eine Wende zu Friedens- und Abrüstungspolitik, zu demokratischem und sozialem Fortschritt erkämpfen« und eine zunächst sehr allgemeine Debatte um das Für und Wieder der antimonopolistischen Strategie in den Parteimedien ließen zunächst das Gegenteil befürchten.
Die Diskussion um die Strategie der KommunistInnen wurde dann aber doch sehr konkret geführt. Dazu hatte auch der zweite zentrale Antrag »Für Frieden, Arbeit, Solidarität – Die DKP stärken!« beigetragen, der abgeleitet aus der allgemeinen Strategiebestimmung im Leitantrag auf das konkrete Eingreifen der Partei und ihre Wiederverankerung in der Arbeiterklasse orientiert. Beide Anträge wurden von den 170 Delegierten bei 30 bzw. 20 Nein-Stimmen und Enthaltungen angenommen.
Der Beginn einer Debatte
Wie ist mit der historisch konkreten Situation der Defensive der Arbeiterklasse und der Arbeiterbewegung umzugehen? Wo hat sie ihre Ursachen? Welche Wege gibt es, um aus dieser Defensive herauszukommen und an die proletarische Revolution heranzuführen? Das waren Leitfragen für die Diskussion. Patrik Köbele führte dazu im Referat des Parteivorstandes aus: »Aus dieser Defensive werden wir ohne die Veränderung des Kräfteverhältnisses nicht herauskommen und diese Defensive bedingt, dass wir es derzeit und in der kommenden Phase vor allem mit Abwehrkämpfen gegen die Angriffe der Herrschenden auf die sozialen und demokratischen Rechte, gegen Militarisierung, Hochrüstung und Kriegspolitik zu tun haben werden. Die Debatte, wie wir diese Kämpfe entwickeln, wie die Arbeiterbewegung aus dieser Defensive herauskommen, das Kräfteverhältnis verändern kann, haben wir mit der Debatte zum Leitantrag begonnen.«
Das Ringen um eine Einschätzung der konkreten Klassensituation in diesem Land und der Drang als DKP wieder politischer Faktor in Klassenkämpfen werden zu wollen, zeigten sich vor allem in der anschließenden Generaldebatte. Sie war bestimmt durch Beiträge aktiver GewerkschafterInnen im Kampf um mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen, aber auch aus anderen Branchen. Über die Rolle der KommunistInnen als weitertreibender Teil der Klasse in diesen Auseinandersetzungen wurde nicht nur theoretisch diskutiert, sondern anhand von konkreten Erfahrungen. Hier zeigte sich die DKP im Praxistest.
Dieser kleine Ausschnitt aus dem Leben der Partei hat sicher nicht die Realität der ganzen Partei abgebildet, aber doch eine neue Qualität aufgezeigt. Bereits der 21. Parteitag der DKP hatte das Wiedererlangen der Verankerung in der Klasse auf die Tagesordnung gesetzt. Er hatte darauf orientiert, wo möglich GenossInnen aus Branchen auf Kreis-, Bezirks- und Bundesebene zusammenzufassen, um Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam über Orientierungen zu beraten. Die Kommission Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit bildete daraufhin die Branchengruppe Gesundheitspolitik. Ihr soll nun eine Branchengruppe der Beschäftigten im Bildungs- und Erziehungswesen folgen.
Arbeiterpolitik stärken
Der Beschluss zur Parteistärkung legt großes Gewicht auf diese Frage: »Um der Verankerung in der Arbeiterklasse wieder näher zu kommen, müssen wir stärker nach außen und an die Massen der Werktätigen herangehen, uns in den Betrieben und Gewerkschaften verankern und die Kämpfe der Beschäftigten und ihrer Organisationen, der Gewerkschaften, aktiv unterstützen. Wir dürfen uns nicht mit der Rolle von Kommentatoren begnügen und müssen als Teil der Bewegung weitergehende Forderungen diskutieren und die Gewerkschaften als Kampforgane der Arbeiterklasse stärken. Dazu brauchen wir das Zusammenführen unserer Erfahrungen in der betrieblichen und gewerkschaftlichen Arbeit und das kollektive Arbeiten unserer Genossinnen und Genossen aus den Betrieben. Wir orientieren deshalb auf den Aufbau von Betriebs- und Branchengruppen. Gleichzeitig wollen wir unsere Arbeiterpolitik in den Kommunen entwickeln. Die Kommunalpolitik ist das zweite Standbein unserer Arbeiterpolitik.«
Mit der Kommunalpolitik ist ein Bereich angesprochen in dem die DKP in den letzten Jahren zentral kaum etwas entwickelt hat. Das ist auch deshalb sträflich, weil sie an vielen Orten qualifizierte Kommunalpolitik macht und über viele Erfahrungen verfügt. Der neue Parteivorstand ist nun beauftragt, eine Kommission Kommunalpolitik zu bilden. Das entspricht dem Anliegen die Leitungsarbeit darauf zu konzentrieren, die Grundorganisationen in ihrer Arbeit und Außenwirkung zu unterstützen.
Denn so richtig die Orientierung auf Betriebsarbeit und Branchengruppen ist, die Realität der DKP sind nach wie vor Wohngebiets und Stadtteilgruppen, zum großen Teil auch Gruppen mit großen Einzugsgebieten. Sie ideologisch und organisationspolitisch zu stärken, ihre Handlungsfähigkeit zu vergrößern, ist Hauptanliegen des Beschlusses »Für Frieden, Arbeit, Solidarität – Die DKP stärken«. Dabei bekommen neben praktischer Unterstützung und Hilfe in der Öffentlichkeitsarbeit die Theorie- und Bildungsarbeit und die Jugendpolitik, vor allem die Zusammenarbeit mit der SDAJ, eine größere Bedeutung.
Der Parteitag und die zahlreichen Anträge aus den Gliederungen zeugten von einer gesunden Ungeduld. Hohe Ansprüche sind von der Basis formuliert in der konkreten Politikentwicklung weiter zu kommen und mehr Anleitung zu bekommen. So wurde insbesondere der Kommission Betriebs- und Gewerkschaftspolitik über Änderungsanträge ein ganzer Katalog konkreter Arbeitsaufträge auf den Weg gegeben – von der Vorbereitung von Betriebsrats- und Organisationswahlen, über die schnellere Positionierung zu Tarifauseinandersetzungen und der kollektiven Forderungsdiskussion im Vorfeld, Schulungen für Aktive in der Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit bis hin zur Unterstützung von Gliederungen bei der Herausgabe von Betriebszeitungen. Erweitert wurde auch der Abschnitt »Unsere Kampfziele und Kampffelder« des Leitantrags um Abschnitte und Ergänzungen zur Gewerkschafts- und Gesundheitspolitik, zur Wohnungspolitik und auch zur Umweltpolitik.
Ohne Frieden ist alles nichts
Als zentrales und erstes Arbeitsfeld bestätigte der Parteitag den Kampf gegen die imperialistische Kriegspolitik. Im beschlossene Leitantrag heißt es: »Strategisches Ziel ist es, die Offensive des Imperialismus zu bremsen und zu stoppen und zu einer Politik des Friedens und der Abrüstung, zu demokratischem und sozialem Fortschritt zu kommen. Das heißt konkret, für die Beendigung aktueller Kriege zu kämpfen und gegen die Gefahr eines die gesamte Menschheit bedrohenden Krieges, ausgelöst durch die NATO-Konfrontation gegen Russland und China und mit der Gefahr des Einsatzes von Atomwaffen. Es geht darum, den Imperialismus der USA, der EU, Deutschlands sowie die NATO, das zentrale militärische Instrument der führenden Imperialismen, an der Unterwerfung anderer Staaten zu hindern.« Und weiter: »Wenn es nicht gelingt einen atomaren Krieg zu verhindern und die weitere Unterjochung und Zerstörung ganzer Staaten durch den Imperialismus zu stoppen, sind alle Vorstellungen von weitergehenden sozialen und politischen Veränderungen illusorisch.«
In der Ableitung heißt es im Antrag zur Parteistärkung: »Die DKP unterstützt die Kampagne der Friedensbewegung »abrüsten statt aufrüsten« gegen die NATO-Forderung nach Steigerung der Rüstungsausgaben auf 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. … Notwendig ist es dabei, den Zusammenhang zwischen Aufrüstung und dem weiteren Abbau sozialer und demokratischer Rechte, sowie die Bedrohung des Friedens und der Sicherheit der Menschen in Europa durch die aggressive NATO-Politik aufzuzeigen. Das ist die inhaltliche Linie, mit der wir in der kommenden Periode in Stadtteilen, Betrieben und Gewerkschaften wirken müssen.«
Mit dem Sammeln von 30.000 Unterschriften hat sich die DKP viel vorgenommen. Die Resonanz ist positiv, etliche ausgefüllte Unterschriftenlisten sind in den Wochen nach dem Parteitag beim Parteivorstand eingegangen. In den Gruppen hat die Diskussion um Aktionsformen und die Sammlung der Unterschriften mit konkreten Zielstellungen begonnen.
Nicht ohne Widersprüche
Mit dem Beschluss des Leitantrags bezog der Parteitag auch Stellung zu Streitfragen in der DKP. Der Entwurf des Dokuments war zuvor vor allem von »links« kritisiert worden. In der Konzeption der »Wende« innerhalb der antimonopolistischen Strategie und der Orientierung auf antimonopolistische Bündnisse und Reformkämpfe werden Gefahren illusionärer Politikentwicklung gesehen. Monate vor dem Parteitag und bevor die Debatte richtig in Gang gekommen war, hatten eine Reihe von GenossInnen die Partei und den Jugendverband an ihrer Seite kollektiv verlassen. Der Parteitag hat klug gehandelt, den Leitantrag nicht als Ende, sondern als Beginn der Debatte zu kennzeichnen. In diesem Sinne beauftrage er den Parteivorstand dem kommenden Parteitag einen Fahrplan vorzulegen, wie an die Überarbeitung des Parteiprogramms von 2006 heranzugehen ist, und gab ihm einen Fragenkatalog auf den Weg, an welchen Punkten die Diskussion weiterzuführen ist.
Unterschiedliche Auffassungen wurden in der Antragsdebatte auch in der Einschätzung der Länder mit sozialistischer Orientierung und ihrer Bedeutung deutlich. Angesichts der Kriegsgefahr und der weltpolitischen Entwicklung wird es wichtiger, dass sich die DKP stärker mit der Entwicklung dieser Länder, insbesondere mit der Entwicklung der Volksrepublik China, die weltpolitisch eine entscheidende Bedeutung hat, befasst. Hier hat der Parteitag gezeigt, dass es großen Diskussionsbedarf gibt.
Mit dem Beschluss über die Unvereinbarkeit der Mitgliedschaft in der DKP mit der Mitgliedschaft im sogenannten Netzwerk kommunistische Politik zog der Parteitag (109 JA-/42 NEIN-Stimmen) eine Trennlinie zur organisationspolitischen Loslösung von GenossInnen, die sich in Grundfragen anders positionieren, gemeinsames Handeln zum Teil aufgekündigt und sich eigene Strukturen für die Diskussion geschaffen haben. Die Debatten und Beschlüsse des 22. Parteitages, die stärkere Gewichtung der Betriebs- und Gewerkschaftspolitik, die Unterstützung der Kampagne »abrüsten statt aufrüsten«, aber auch die Beschlüsse zur Fortführung der Debatte sind auch an diese GenossInnen eine Einladung, sich wieder einzureihen und in der Partei und ihren Strukturen um Standpunkte zu ringen.
Der 22. Parteitag wählte einen 32-köpfigen Parteivorstand. Neben Patrik Köbele als Vorsitzender, wurden Hans-Peter Brenner und Wera Richter als seine StellvertreterInnen bestätigt. Eine Reihe neuer und jüngerer GenossInnen konnten für das Gremium gewonnen werden. Personell gestärkt wurden die Bereiche Theorie- und Bildungsarbeit, Betriebs- und Gewerkschaftspolitik, Kommunal- und Umweltpolitik. Die Ansprüche an dieses Gremium und seine Verantwortung zum Erhalt und zur Stärkung einer lebendigen und ausgehend von der konkreten historischen Situation um den richtigen Weg, um die richtige Strategie und Taktik, streitenden Partei, sind hoch.
(Alle Referate und Beschlüsse des Parteitages sind nachzulesen im Internet unter http://news.dkp.suhail.uberspace.de/2018/03/informationen-des-22-parteitags-der-dkp-2-bis-4-maerz-2018/)
Editorial
»Die Propaganda für das Denken, auf welchem Gebiet sie immer erfolgt, ist der Sache der Unterdrückten nützlich. Eine solche Propaganda ist sehr nötig. Das Denken gilt unter Regierungen, die der Ausbeutung dienen, als niedrig.« Schreibt Bertolt Brecht in seinen immer wieder inspirierenden »Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit«. Und in seinem »Me-ti, Buch der Wendungen« definiert er: »Denken ist etwas, das auf Schwierigkeiten folgt und dem Handeln vorausgeht.«
Nun genießt der 200. Geburtstag von Karl Marx in diesem Jahr mit allerlei Ge-Denkveranstaltungen, Ausstellungen, Konferenzen, Publikationen und sogar einem ZDF-»Dokudrama« mit Mario Adorf als »Der deutsche Prophet« deutlich mehr öffentliche Aufmerksamkeit als der 120te von Bert Brecht. »Leider«, möchte ich fast sagen, da ich zu jenen gehöre, die als Jugendliche über Brecht’sche Werke bei den Recklinghäuser Ruhrfestspielen Marx’sches Denken entdeckt/gelernt haben, bevor sie sich ans Original trauten. Der Beitrag von Jenny Farrel über Brechts ver-dichtetes »Manifest der Kommunistischen Partei« verbindet die beiden Jubiläen und zeigt am Beispiel, wie sehr Marx Brecht als Dichter bewegt hat.
Beim Ge-Denken an Marx200 stehen bei uns »Orthodoxen« (manch »Unorthodoxer« glaubt es kaum) nicht Historie, Nostalgie, atheistische »Gedenkgottesdienste« oder Zitier-Wettbewerbe auf dem Plan, sondern der Blick auf die Entwicklung Marx’schen Denkens, was Unabgeschlossenheit, Aktualitäts- und Weiterentwicklungspotenzial für Denken und Handeln voraussetzt. Zu den Beiträgen in Kürze:
Dietmar Dath, erinnert sich an seine erste Begegnung mit Marx und schildert, was er heute noch bedeutet. Holger Wendt verteidigt in seinem Essay den »authentischen« Marxismus in seiner Gänze, als System und kollektives Projekt gegen ein »eklektisches« Verständnis, »welches Marx zwar als Ideengeber würdigt, die Gesamtsystematik seines Werkes jedoch aufsprengt, es zum intellektuellen Steinbruch herabstuft, Kerninhalte entsorgt«. Der viel beachtete Vortrag von Georg Fülberth bei der diesjährigen Jahresmitgliederversammlung der Marx-Engels-Stiftung »Marx als Produkt« beantwortet, wovon wir reden, wenn wir über 200 Jahre Karl Marx reden. Eine kurze Einführung in die Entwicklung der »Großen Methode«, das »Dialektische Denken«, gibt Richard Sorg. Im Beitrag »Karl Marx über Dienstleistungen« veranschaulicht Klaus Müller, dass die Frage, welcherart Arbeit Dienstleistungsarbeit ist – produktiv oder unproduktiv, wertbildend und Ware oder nicht? – keineswegs nur für detailversessene Politökonomen von Interesse ist, sondern für alle, die eine genaueres Bild von der Arbeiterklasse als »Subjekt der Veränderung« brauchen. In seinem Buch »Integrativer Marxismus« skizziert Thomas Metscher Felder der theoretischen Erweiterung des Marxismus, wovon wir seine Anregungen für eine »politische Ethik« und einen »neuen Humanismus« vorstellen. Abgeschlossen wird unser Schwerpunkt mit Reflexionen von Wolfgang Jantzen nach der Lektüre zweier Bücher von Kohei Saito und Daniel Stosiek über »Mensch, Natur, Kapital und Befreiung – Mit Marx über Marx hinaus.«
In Erwägung, dass die Weiterentwicklung Marx’schen Denkens nur als kollektives Projekt Erfolg verspricht, empfehlen wir unseren Leser*innen auch die »Marx200«-Ausgaben der Zeitschrift »Z. Marxistische Erneuerung« und der SPD-nahen Zeitschrift SPW zur Lektüre, wissend, dass kluge, sozialdemokratische Marxist*innen in der gegenwärtigen Regierungs- und Gewerkschaftspraxis nicht sonderlich wirk-mächtig sind. Eine Schwierigkeit, über die es sich 2018 besonders lohnt gemeinsam nachzudenken und dann auch zu handeln.LoG
Kritik an der Macht UND an der Ohnmacht oder Warum es ohne Marx keine Politik gegen das Unrecht gibt[1]
Dietmar Dath[2]
Ich war noch keine fünfzehn Jahre alt, als ich das erste Mal vor einer Wand voller Bücher stand, die alle in irgendeiner Richtung gegen das Unrecht argumentierten, darüber schimpften, daran herumdachten. Welches Buch sollte ich zuerst lesen? Ich weiß nicht mehr, welches ich mir rausgezogen habe. Ich weiß aber, was mir die Wand voller Bücher deutlicher gemacht hat, als das jedes einzelne Buch gekonnt hätte: Es gab und gibt sehr viele Theorien über den richtigen Weg zu einem Leben, in dem niemand mehr ausgeschlossen, eingesperrt, ausgebeutet oder unterdrückt wird. Und es gibt mehr Klagen als Theorien über all diese Formen des Unrechts. Das Besondere am Werk von Karl Marx ist aber, dass er kaum klagt, und dass er da, wo er Theorie treibt, dem Unrecht sozusagen sein Recht gelassen hat: Er glaubte weder, dass der Grund fürs Unrecht ein unerklärliches Urböses in den Menschen sei, noch ging er davon aus, die Gründe fürs Unrecht könne man einfach ignorieren, wenn man das bessere Leben will.
Stattdessen sah er die Frage nach dem Unrecht wie auch die Frage nach den Wegen aus diesem Unrecht als historische Probleme an und untersuchte (objektive) Ursachen wie (subjektive) Gründe dafür, warum die Menschen sich die Welt so eingerichtet hatten, wie sie sich ihm zeigte, als hässlichen Kampfplatz der Klassen nämlich.
Wie gerecht es zwischen Menschen allenfalls zugehen kann, so fand er heraus, hängt davon ab, wie reich die Gesellschaften sind, in denen sie leben. Wer sich mit der nackten Naturnot herumschlagen muss, braucht simple soziale Verhältnisse von Befehl und Gehorsam, denn alles, was besser ist als Befehl und Gehorsam, zum Beispiel die Abstimmung der Menschen untereinander, die Selbstverwaltung, fordert Zeit, die nur zur Verfügung hat, wer nicht ums Überleben kämpft.
Die kapitalistische Gesellschaft wurde und wird von den utopischen Sozialisten, Kommunisten und Anarchisten, die Marx vorangegangen waren, ihn umgaben und ihm folgten, nur als Unrechtsquelle gesehen. Marx aber erkannte sie als den Ort, an dem der gesellschaftliche Reichtum (genauer: die Produktivität, die ihm zugrunde liegt) den höchsten Stand in der bisherigen Menschheitsgeschichte erreicht hatte. Damit begriff er sie als die endlich geschaffene Voraussetzung dafür, die Lasten des Unrechts insgesamt abzuwerfen und in ein Zeitalter der Selbstverwaltung, Selbstbestimmung, Selbstemanzipation der Menschen einzutreten.
Der Dichter und Marxist Bertolt Brecht fasst die Einsichten, die Marx an diesem Punkt vollzogen hatte, in seinem »Buch der Wendung« sehr richtig mit den Worten zusammen: »Diejenigen, welche sagen: Wenn die Ausbeutung der Menschen abschaffbar wäre, dann wäre sie schon längst abgeschafft, sind im Unrecht. Sie war immer drückend, aber sie konnte nicht immer abgeschafft werden.«
Dass der Kapitalismus die Produktivität auf den Stand gehoben hat, der die Abschaffung des Unrechts erlaubt, ist aber nur die erste unverzichtbare Erkenntnis, auf die Marx bei der Kritik der stärksten gesellschaftlichen Macht stieß, die es überhaupt gibt, der Macht über die Produktion. Welche Klasse, die es erst im Kapitalismus gibt, diese Abschaffung des Unrechts aber leisten muss, weil das keine andere kann, ist die zweite Einsicht: Es ist die Klasse derjenigen, die »nichts zu verlieren haben als ihre Ketten«, das heißt derjenigen, die nichts besitzen außer ihrem Arbeitsvermögen, die also keine Arbeit anderer kommandieren können. Sie sind nur als Abhängige an der Schaffung und Mehrung des gesellschaftlichen Reichtums beteiligt, ansonsten davon ausgeschlossen, in ihre Arbeitszwänge eingeschlossen, ausgebeutet und unterdrückt von den Besitzenden, Herrschenden, Verwaltenden der kapitalistischen Welt. Die dritte der großen Einsichten von Marx ist die folgenreichste: Die Wahrheit, dass keine politische Bewegung, der die Kenntnis der ersten beiden Einsichten fehlt oder auch nur die Bereitschaft, aus ihnen die Konsequenzen zu ziehen, die geringste Chance hat, das Unrecht abzuschaffen. Klagen über das Unrecht helfen nicht, analytisch unterentwickelte Theorien über eine mögliche Welt ohne Unrecht helfen nicht: Das ist die Kritik der Ohnmacht der Utopie, die bei Marx die Kritik der Macht der Realität ergänzt.
Das heißt nicht, dass es bei der Abschaffung des Unrechts ohne die vielen Menschen gehen wird, die auch heute klagen oder Theorien über eine mögliche Welt ohne Unrecht basteln. Man muss den Spiegelungen, die das Unrecht in ihren Klagen und Theorien erfährt, so sehr ihr Recht lassen (eben als Spiegelungen, Reflexe, Reflexionen), wie Marx das getan hat, selbst bei Gegnern. Dem französischen Anarchosozialisten Pierre-Joseph Proudhon hat Marx in ausführlichen kritischen Schriften so ziemlich jeden Denkfehler nachgewiesen, den man bei der Betrachtung der kapitalistischen Gesellschaft und beim Entwurf eines Programms zur Überwindung des Unrechts überhaupt machen kann. Umso bemerkenswerter sind die Sätze die Marx über Proudhon in einem Brief an P.W. Annenkow vom 28. Dezember 1846 schreibt. Sie tun den Gegner nicht einfach ab oder verurteilen ihn, sondern benennen die Ursachen und Gründe seiner Irrtümer so klar, wie Marx anderswo die Ursachen und Gründe des Unrechts benannt hat: »Er ist geblendet von der Herrlichkeit der Bourgeoisie und hat Mitgefühl mit den Leiden des Volkes. (…) Ein solcher Kleinbürger vergöttert den Widerspruch, weil der Widerspruch der Kern seines Wesens ist. Er ist selbst bloß der soziale Widerspruch in Aktion. Er muss durch die Theorie rechtfertigen, was er in der Praxis ist, und Herr Proudhon hat das Verdienst, der wissenschaftliche Interpret des französischen Kleinbürgertums zu sein, was ein wirkliches Verdienst ist, da das Kleinbürgertum ein integrierender Bestandteil aller sich vorbereitenden sozialen Revolutionen sein wird.«
Ich habe diese Sätze das erste Mal als Jugendlicher gelesen, Mitte der Achtziger Jahre, und sie haben mir das unerklärliche Denken und Handeln von Menschen erklärt, mit denen ich und andere gemeinsam etwas gegen das Unrecht hatten tun wollen, die dann aber immer wieder ihr allerseltsamstes Zurückweichen vor den Herrschenden, Besitzenden, Verwaltenden auf wirre Weise begründeten.
Seither waren es in meiner Umgebung stets Marxistinnen und Marxisten, die in der Auseinandersetzung mit den GRÜNEN bis zu Debatten mit den heute schon wieder fast ganz verschwundenen PIRATEN die notwendige Kritik an Menschen mit oft ehrenhaften Motiven, aber zutiefst inkonsequenter bis schädlicher Praxis leisteten.
Man kann nicht nur das Unrecht ohne die drei Einsichten von Marx (und viele hinführende und verbindende Überlegungen in ihrem Zusammenhang) weder verstehen noch bekämpfen, man hat außerdem ohne sie auch kein Werkzeug, die Irrtümer, die beim Kampf gegen das Unrecht begangen werden, zu verstehen, zu korrigieren oder zu vermeiden.
Die Kritik am Falschen und die Kritik an falschen Angriffen wider das Falsche sind nirgends in der Geschichte des Denkens und Handelns gegen das Unrecht eine überzeugendere, kraftvollere, beweglichere Einheit eingegangen als im Werk von Karl Marx.
Deshalb bleibt dieses Werk lebenswichtig für alle, die sich nicht abfinden wollen mit den menschenunwürdigen Zuständen, in denen wir leben.
[1] Vorabdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlages aus: Lena Kreymann/Paul Rodermund (Hg.) Eine Welt zu gewinnen. Marx, der Kapitalismus von heute und was wir tun können; Paperback, 180 Seiten, ca. Euro 12,90; ISBN 978-3-89438-674-0 PapyRossa Verlag, Köln 2018 (Frühsommer)
[2] Dietmar Dath, Autor von Romanen, Comics sowie Theaterstücken. Arbeitet als Journalist und Übersetzer. Zuletzt erschienen: »Karl Marx. 100 Seiten«, Philipp Reclam jr., 2018, kart., 10,00 €
Authentischer Marxismus als Programm
Ein Essay
Holger Wendt[1]
Anlässlich des 150sten Erscheinungsjahres des ›Kapital‹ und anlässlich seines zweihundertsten Geburtstages wird Marx selbst an Orten gewürdigt, an denen man anderes zu lesen gewohnt ist. Nehmen wir Hans-Werner Sinn zum prominenten Beispiel. In der ›Zeit‹ beklagt er, der Autor des ›Kapital‹ werde »wegen der Arbeitswerttheorie und wegen der offenkundigen Fehlleistung Marx’ im Bereich der Verteilungstheorie« von angelsächsischen Ökonomen nicht als jemand wahrgenommen, der Wesentliches zur Geschichte der ökonomischen Lehrmeinungen beigetragen habe. Dies sei jedoch ein Fehler, »denn die wahre Leistung von Marx liegt in der Makrotheorie. Er war einer der ersten Makroökonomen der Geschichte und hat diese Teildisziplin wesentlich begründet«. An anderer Stelle schreibt Sinn: »Marx’ wahre Leistung liegt in der makroökonomischen Theorie, also in seinen Erkenntnissen über die gesamte Volkswirtschaft. Die wichtigsten Beiträge zur volkswirtschaftlichen Erkenntnis liefern seine Krisentheorien. Eine besondere Bedeutung kommt dabei der Theorie vom tendenziellen Fall der Profitrate zu, die im dritten Band des Kapitals entwickelt wird.«[2]
Was macht Sinn aus diesem merkwürdigen Lob einer Theorie des Profitratenfalls, deren arbeitswerttheoretische Grundlage er als Fehlleistung ansieht, »mehr Ideologie als Erkenntnis«? Er nutzt sie zur Anklage eines durch Staatsinterventionen verkrusteten, der schöpferischen Zerstörung nicht mehr fähigen Kapitalismus:
»Aus dem nach Marx nur tendenziellen Fall der Profitrate wird heute ein durch die Geldpolitik administrierter, massiver Rückgang, der in einem schleichenden Siechtum endet. Dieses Siechtum sieht wie eine Säkulare Stagnation aus, die aufgrund der Erschöpfung der Investitionsmöglichkeiten zustande kommt. Sie ist aber in Wahrheit durch eine Zentralbankpolitik verursacht, die den Interessen der Altbanken, Altfirmen und alten Vermögensbesitzer dient und dadurch den Prozess der schöpferischen Zerstörung verhindert. Die Konsequenz ist, dass der Kapitalismus verkrustet und durch ausufernde Rettungsaktionen der Zentralbanken allmählich zu einer staatlich gesteuerten Wirtschaft mutiert, die mit einer Marktwirtschaft nicht mehr viel gemein hat.«[3]
Auf Sinns Lob des Marxschen Satzes, das Sein bestimme das Bewusstsein, folgt eine Polemik gegen Versuche, kapitalistischer Barbarei Schranken zu setzen:
»Systeme, die sich nicht an den Gesetzmäßigkeiten menschlichen Verhaltens und der objektiven Knappheit der Ressourcen orientieren, sondern aufgrund bloßer Wunschvorstellungen von Ideologen, Theologen oder Ethikern eingerichtet werden, gehen unter, weil sie ökonomisch nicht funktionieren und dem Wettbewerb mit anderen Systemen nicht standhalten. Ironischerweise sind es gerade linke Politiker, die an die Möglichkeit politischer Interventionen in das Marktgeschehen glauben, während die Ökonomen auf die Dominanz der ökonomischen Gesetze verweisen und viele der Interventionen als unwirksam, wenn nicht kontraproduktiv zurückweisen.«
Marx wird geplündert, um mit dekontextualisierten Versatzstücken seiner Theorie eine wirtschaftspolitische Agenda zu affirmieren, die das glatte Gegenteil der Marxschen Zielstellungen ist. Vom größten Dampfplauderer der deutschen Ökonomenzunft steht anderes nicht zu erwarten. Wenngleich eingeräumt werden muss, dass Hans-Werner Sinn ein überaus dankbares Beispiel abgibt, so steht er doch keineswegs alleine. Da alle Versuche, Marx für obsolet zu erklären, seit anderthalb Jahrhunderten stets und ständig scheitern, erscheint das vergiftete Lob als erfolgversprechendere Alternative. Marx wird nicht zur Gänze verworfen, sondern »differenziert« betrachtet – nur die Kerninhalte seiner Werke gehen über die Wupper. Im verbleibenden Rest findet sich immer die ein- oder andere Rosine, die man zum Zwecke reaktionären Räsonierens herauspicken kann.
Marxens wohlmeinende Entmarxung
Wie steht es aber mit jenen Ökonomen, die nicht als neoliberale Demagogen reüssieren, die der politischen Linken zuzurechnen sind, obendrein als herausragende Marx-Experten gelten? Das Marx-Lob mag in diesen Kreisen mehr von Herzen kommen, mit politisch sympathischen Absichten formuliert werden, doch finden sich selbst hier, beabsichtigt oder nicht, wohlmeinende Attacken auf Kerninhalte des Marxschen Werkes.
Wohlmeinend nenne ich diese Sorte Kritik deshalb, weil man den Kritikern unterstellen kann, sie strebten nicht wie dereinst Ritter Eugen von Böhm-Bawerk oder heutzutage Hans-Werner Sinn eine Marx-Demontage an. Sie wollten, wenigstens anfangs, den Marxismus verbessern, von vermeintlichen Schwächen befreien, ihn wissenschaftlich moderner und politisch schlagkräftiger machen.
Zu den beliebtesten Zielen wohlmeinender Fundamentalkritik zählt der Marxsche Wertbegriff. Ein zeitweilig einflussreiches Exempel ist nachzulesen in Paul Barans und Paul M. Sweezys klassisch zu nennendem Buch ›Monopolkapital‹. Die Autoren erklären, in der Epoche der großen Monopole sei Marx’ Werttheorie nicht länger angemessen:
»Nachdem die Preiskonkurrenz gebannt ist, haben die Verkäufer einer bestimmten Ware oder eines ihr nahekommenden Substitutes ein Interesse daran, daß die Profite der Gesamtgruppe so hoch wie möglich steigen. Sie mögen darum kämpfen wie diese Profite aufgeteilt werden […] aber keiner wird wollen, daß die Gesamtsumme, um die gekämpft wird, kleiner statt größer wird. Dieser Umstand ist entscheidend für die Preispolitik und Strategie der typischen Großgesellschaft. Und das bedeutet, daß als allgemeine Preistheorie einer Wirtschaft, die von solchen Gesellschaften beherrscht wird, die traditionelle Monopolpreistheorie der klassischen und neoklassischen Nationalökonomie die angemessene ist.«[4]
Marx’ Arbeitswertlehre und folglich sein Gesetz des tendenziellen Profitratenfalls sind damit obsolet:
»Wenn wir das Gesetz der fallenden Profitrate durch das Gesetz des steigenden Surplus ersetzen, weisen wir damit nicht einen geheiligten Lehrsatz der politischen Ökonomie zurück; wir revidieren ihn auch nicht, wir berücksichtigen lediglich die unzweifelhafte Tatsache, daß die kapitalistische Wirtschaft einem grundlegenden Wandel unterworfen gewesen ist, seit dieser Lehrsatz aufgestellt worden ist.«[5]
Waren Baran und Sweezy Reaktionäre? Kaum. Sie bemühten sich um eine an Marx anknüpfende Theorie, die moderne Phänomene des Kapitalismus, die nach Marx’ Lebzeiten in Erscheinung traten, zu erklären vermag. Der Wertbegriff des ›Kapital‹ erschien ihnen als einer vergangenen Epoche zugehörig, somit als einer zeitgemäßen linken Theoriebildung abträglich.
Ein anderer Ansatz wohlmeinender Fundamentalkritik der Arbeitswerttheorie ist verbunden mit dem Namen Ian Steedman, einem weit linksstehenden, ehedem marxistischen Ökonomen. Steedman knüpfte an Piero Sraffas wichtige Schrift »Warenproduktion mittels Waren« an. Was bei Sraffa als komplexe mathematische Lösung des von Engels aufgeworfenen Transformationsproblems angelegt war, entwickelte sich zum Argument gegen die Arbeitswertlehre:
»Auf Basis von Annahmen, die in Marx’ eigener Politischer Ökonomie zu finden sind, wurde bewiesen, das Marx’ Wertdenken oft in sich inkonsistent ist, es komplett damit scheitert, die Erklärungen zu liefern, die Marx für bestimmte zentrale Eigenschaften der kapitalistischen Wirtschaft gesucht hat. […] Marx’ Wertbegriff – kaum ein nebensächlicher Aspekt seiner Arbeit – muss daher im Interesse der Entwicklung einer kohärenten materialistischen Theorie des Kapitalismus aufgegeben werden.«[6]
Aktuellere Beispiele wohlmeinender Attacken auf den Marx’ Wertbegriff tummeln sich im Umfeld der sogenannten Neuen Marxlektüre. Zu den zentralen Topoi dieser Richtung zählt die Polemik gegen eine »substanzialistische Werttheorie«, die einerseits als inkompetente »traditionsmarxistische« Entstellung des Marxschen Werkes dargestellt wird, andererseits aber in Marx Verständnis der abstrakten Arbeit als Wertsubstanz bereits angelegt sei. Es geht um Marxsche Aussagen wie diese:
»Alle Arbeit ist einerseits Verausgabung menschlicher Arbeitskraft im physiologischen Sinn, und in dieser Eigenschaft gleicher menschlicher oder abstrakt menschlicher Arbeit bildet sie den Warenwert. Alle Arbeit ist andrerseits Verausgabung menschlicher Arbeitskraft in besondrer zweckbestimmter Form, und in dieser Eigenschaft konkreter nützlicher Arbeit produziert sie Gebrauchswerte.« (MEW 23/61)
Bei Marx ist abstrakte Arbeit konkrete Arbeit, von deren konkreten Bestimmungen im Austauschprozess objektiv abgesehen (real abstrahiert) wird. Als solche behält sie engen Bezug zu den realen materiellen Reproduktionsprozessen, zum physischen Stoffwechsel des Menschen mit der Natur, bleibt sie »produktive Verausgabung von menschlichem Hirn, Muskel, Nerv, Hand usw.« (MEW 23/58).
Die Neue Marxlektüre sieht darin eine theoretische Inkonsequenz Marxens. Die enge begriffliche Verbindung der abstrakten zur konkreten Arbeit und damit zum wirklichen Arbeitsprozess wird als »naturalistisch« gekappt. Ins Zentrum rückt ein in der Zirkulationssphäre beheimatetes »Geltungs-« bzw. »Anerkennungsverhältnis«. Typische Formulierungen lauten:
»[…] ›abstrakte‹ Arbeitszeit ist derjenige Anteil der vom individuellen Produzenten privat verausgabten konkreten Arbeitszeit, der im Tausch als Bestandteil der gesellschaftlichen Gesamtarbeit anerkannt wird.«[7]
»Abstrakte Arbeit ist zum einen durch die Produktivkraft der anderen Produzenten, zum anderen durch die Bedürfnisse und Solvenz der Konsumenten bestimmt. Der Wert ist daher eine Eigenschaft, die der Ware vor ihrem Austausch noch gar nicht zukommen kann.«[8]
»Dementsprechend ist abstrakte Arbeit nicht nur insofern gesellschaftlich bestimmt, als sie von der Produktivkraft der Arbeit und der zahlungsfähigen Nachfrage abhängig ist, sondern auch insofern, als soziale Wertschätzungen in sie eingehen. Anders gesagt weist abstrakte Arbeit eine Anerkennungsdimension auf – die Marx jedoch nicht eigens thematisiert, sondern die hinter naturalistischen Anklängen verborgen bleibt. So ist die Formulierung, jede Arbeit sei ›einerseits Verausgabung menschlicher Arbeitskraft im physiologischen Sinn‹ und ›andrerseits Verausgabung menschlicher Arbeitskraft in besondrer zweckbestimmter Form‹ [MEW 23, 61] überaus problematisch, ganz gleich, was man unter Arbeitskraft schlechthin nun versteht […]«[9]
Am weitesten geht Helmut Reichelt, einer der Gründerväter der »Neuen Marxlektüre«:
»Das bedeutet auch, dass es einen Wertbegriff im Marxschen Sinne nicht mehr gibt […]. Wir müssen vielmehr unterscheiden zwischen der Wertvorstellung und dem Geldbegriff. Der Geldbegriff beruht auf einer Gedankenbewegung, in der die Menschen ›bei Gelegenheit des Austausches‹ Einheit setzen, ein nicht übergehendes Übergehen des Gedanken, der Einheit in der Zweiheit setzt, Einheit und Vielheit zugleich. […] Aber es bleibt – wenn auch nicht vorstellbar – eine Gedankenbewegung, die sich im Kopf der Beteiligten vollzieht, eine identische Gedankenbewegung in jedem Einzelnen.«[10]
Sweezys monopoltheoretische, Steedmans neoricardianische und Reichelts neomarxistische Variante der Zurückweisung des Marxschen Wertbegriffes sind miteinander inkompatibel; dies ist jedoch nicht der Punkt. Da das Ob bzw. das Inwiefern ihrer jeweiligen Berechtigung im Rahmen dieses Aufsatzes nicht in angemessen diskutiert werden kann, möchte ich – zumindest hier – gar nicht behaupten, solche Ansichten seien falsch. Es geht lediglich um die Illustration einer Problematik:
Sweezy, Steedman, Reichelt et. al. sind nicht angetreten, Marx zur Gänze abzuservieren. Sie korrigieren ihn lediglich in einem Einzelpunkt. Doch dieser Punkt ist kein Detailpunkt. Der Marxsche Wertbegriff bildet das Fundament seines ›Kapital‹, auf ihm baut die Argumentation der Marxschen Hauptwerke auf. Ohne ihn hängt die theoretische Entwicklung der drei Bände in der Luft. Zudem ist Marx’ Arbeitswertlehre kein pfiffig ausgeklügeltes Verfahren zur Bestimmung von Austauschverhältnissen, das durch ein pfiffigeres ersetzt werden könnte. Sie ist kein isoliertes ökonomisches Theorem, dessen Zurückweisung vielleicht die marxistische Politische Ökonomie affiziert, die nichtökonomischen Aspekte des Marxismus jedoch unberührt ließe. Im Umfeld der sogenannten »Neuen Marxlektüre« trifft man auf die Auffassung, die zentrale Stellung der Arbeit im traditionellen Marxismus sei Ausfluss eines romantischen Proletkults, einer quasi-religiösen Hoffnung in die zur Menschheitsbefreiung berufenen Arbeiterklasse. Diese Auffassung ist falsch.
Proletkult hin oder her: Die Zentralstellung der Arbeit ist notwendige Konsequenz der Marxschen Betrachtung das Mensch-Naturverhältnisses sowie seines Begriffes von Gesellschaftlichkeit. Arbeit – wirkliche Arbeit, kein bloßes »Geltungsverhältnis« – ist die bewusste Vermittlung des Stoffwechsels zwischen Mensch und Natur, bildet die notwendige materielle Grundlage aller menschlichen Gesellschaften. Es ist kein Symptom von Blaumannromantik, wenn Engels die Arbeit als das Moment bestimmt, das die Menschheit vom Tierreich scheidet. Es ist keine traditionalistische Inkonsequenz, wenn Lukács die Arbeit ins Zentrum seiner Gesellschaftsontologie stellt. Ebenso wenig sind Marx’ Begriffe von Arbeit, abstrakter Arbeit und Wert Ausfluss seiner a) historisch beschränkten Sichtweise oder b) seiner mathematischen Schwächen oder c) seiner unterkomplexen Berücksichtigung von Anerkennungsverhältnissen. Der Arbeits- und folglich der Wertbegriff des ›Kapital‹ ist eng mit den fundamentalen Bestimmungen verknüpft, die seinem Gesamtwerk zugrunde liegen. Allen drei obengenannten Kritiken ist gemein, dass es ihnen an einer angemessenen Reflexion der systematischen Stellung der von ihnen angegriffenen Begriffe mangelt.
Heißt dies, der Marxsche Wertbegriff dürfe nicht zurückgewiesen werden? Mitnichten. Sollte er sich als falsch erweisen, dann ist er falsch. Es heißt aber, dass wir uns der Implikationen einer solchen Zurückweisung bewusst sein müssen. Nicht deswegen, weil jede Kritik zurückzuweisen wäre, deren Konsequenzen nicht gefallen. Sondern deswegen, weil die Infragestellung eines zentralen Aspektes eines wissenschaftlichen Systems das System als Ganzes infrage stellt. Dies macht es unabdingbar, Positionen wie die oben dargestellten ernsthaft zu prüfen. Sind die vorgetragenen Argumente wirklich zwingend? Hat sich Marx tatsächlich einer grundlegend fehlerhaften Wertbestimmung schuldig gemacht? Oder nicht vielmehr seine diversen Modernisierer?
Dogmatismus und sein falsches Gegenteil – Ein Exkurs
Dies ist leider nicht so selbstverständlich wie es klingt. Zwei komplementäre Untugenden sind Gang und Gäbe: Neben der dogmatischen Fraktion, die jeden Zweifel an lieb gewonnenen Lehrsätzen vom Tisch wischt, existiert eine andere, sich als undogmatisch definierende, die dazu neigt, jeden Zweifel am Zweifel als Dogmatismus zu verschreien. Beides führt in die Irre. Um dies zu illustrieren, erlaube ich mir eine – möglicherweise unfaire, hoffentlich den Punkt verdeutlichende – Analogie zu einer anderen wissenschaftlichen Disziplin:
Die Homöopathie, Deutschlands beliebteste Alternativmedizin, geht davon aus, ihre Wirkstoffe wirkten umso stärker, je weiter sie verdünnt (»potenziert«) werden. Die vorgeblich wirksamsten »hochpotenzierten« homöopathischen Arzneimittel sind vollständig wirkstofffrei. Diese Vorstellung trifft in der wissenschaftlichen Medizin auf schroffe Ablehnung, weswegen Homöopathen sich öffentlichkeitswirksam als unorthodoxe Kritiker des schulmedizinischen Dogmatismus in Szene setzen.
Mit ihren Auffassungen stellen Homöopathen nicht nur einen isolierten Aspekt der Medizin bzw. der Pharmakologie in Frage, sondern elementare Grundlagen von Biologie, Chemie und Physik, in der Konsequenz die Grundpfeiler des modernen naturwissenschaftlichen Weltbildes. Andererseits produzieren der Homöopathie verbundene Organisationen regelmäßig Studien, die die Wirksamkeit des einen oder anderen homöopathischen Arzneimittels zu belegen scheinen.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2018
- ISBN (Buch)
- 9783961700134
- ISBN (ePUB)
- 9783961703135
- ISBN (PDF)
- 9783961706136
- Dateigröße
- 1.6 MB
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2018 (April)
- Schlagworte
- Marxismus Marxistische Blätter Neue Impulse Verlag Karl Marx DKP Parteitag Deutsche Kommunistische Partei Karl Marx Geburtstag